Väterliche Erbschaften – Universität Bern Salongespräche WS 2007-2008
 Wird geladen …
Wird geladen …
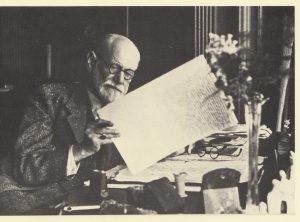
Universität Bern
Salongespräche WS 2007-2008
“In allem meinem Denken stand ich unter Deinem schweren Druck”, heisst es in Franz Kafkas “Brief an den Vater”, der nie an diesen gelangte. Kritik und Klage standen dem Sohn nicht zu, das Gefühl von Schuld, von Ungenügen und Versäumnis, von noch mehr Schuld zermalmten ihn. Dagegen findet sich in René Char’s Aphorismen, dass “unserer Erbschaft keinerlei Testament vorausgegangen ist”, es liege an uns Menschen, damit umzugehen.
Die Vater-Sohnbeziehung wird in diesem Semester Gegenstand der philosophischen und psychoanalytischen Untersuchungen sein. Jeder Vater ist Sohn eines Vaters, der auf den Sohn und dieser auf den nächsten ein Tabu hierarchischer Macht überträgt, ob er präsent sei oder ob er fehle. Was über älteste Mythologie in der abendländischen Kultur mit der Schöpfungsmacht des göttlichen Urvaters begann, setzte sich innerhalb der patriarchalen Strukturen in der Wiederholung von Gehorsamsforderung und Strafe, von Rache und Ohnmacht, von Mangel und Verherrlichung oder von einer anderen, eventuell tatsächlich schöpferischen Entwicklung fort.
Doch wie und warum? Wie viel Angst und hemmende Unterdrückung oder wie viel Ansporn, Widerstand und letztlich Freiheit verbindet sich mit dem Tabu gegenüber väterlicher Macht oder Gewalt, die als väterliche Liebe erklärt wird? Was geht mit der Infragestellung des Tabus einher? Wie wird der mangelnde Vater erlebt? Wie wirkt sich die Vaterbeziehung in der Beziehung zum eigenen Ich, in der Beziehung zur Mutter und weiteren Familienmitgliedern oder in anderen Beziehungen aus, die durch hierarchische Strukturen bestimmt werden? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der individuellen Vaterbeziehung und kollektiven Entwicklungen? Warum ist Vertrauen eine seltene Tatsache?
Eine kleine Auswahl von Texten – insbesondere von und in Zusammenhang von Sigmund Freud, Franz Kafka, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Hannah Arendt, René Char etc. -, werden die sechs Abende begleiten. Immer bleibt Zeit für die persönlichen Betrachtungen und Überlegungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Weiterbildung.
Herkunftsgeschichte – Vatergeschichte
- Vorlesung
Jeder Vater ist Sohn eines Vaters, der selber Sohn eines Vaters ist, oft eines unbekannten, entschwundenen, abwesenden Vaters, trotzdem eines Vaters, durch dessen Zeugungskraft ein Kind geschaffen wird, im mütterlichen Leib getragen und aus ihm geboren, durch mütterliche Nähe gross gezogen, Töchter und Söhne, die im menschlichen Beziehungsgeflecht wieder zu Vätern werden und zu Müttern, weiter und weiter zurück bis zu den nicht mehr benennbaren Anfängen und weiter voran bis in die Jetztzeit und weiter. Töchter und Mütter, ja die ganze Komplexität in der Herkunfts-, Entwicklungs- und Beziehungsgeschichte von Frauen war in den Untersuchungen der vergangenen Jahre für mich von zentraler Bedeutung. Der Einfluss der Väter – der gewaltigen, ängstigenden Väter, der schützenden, vorbildlichen Väter, der fehlenden Väter – wurde beachtet, jedoch nicht in der transgenerationellen patriarchalen Abfolge mit dem ganzen hierarchischen Geflecht, das in die ältesten Mythologien zurückreicht, das aus den Familiensystemen in die Religionen sowie in die staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herrschaftsstrukturen übersetzt wurde und das weiterwirkt. Diesen Zusammenhängen nachzugehen, insbesondere der Frage, wie die nicht wählbare väterliche Erbschaft sich auswirkt, wie sie angenommen werden kann, mit wie viel Freiheit sie umgesetzt, erweitert und verändert werden kann, erscheint mir wichtig.
Ich werde dabei einerseits meine persönlichen Arbeitsergebnisse, andererseits veröffentlichte Texte, die Zeugnis persönlicher Erfahrungen oder wissenschaftliche Kenntnisse sind, miteinander in Verbindung bringen. Die psychoanalytische Arbeit ermöglicht eine ebenso weite und vertiefte Verarbeitung vielfältiger Vaterbeziehung wie die grosse Literatur, welche die Bibliotheken füllt. Dabei gibt es kaum ein Dokument, das nicht das Interesse weckt.
Der eigene Vater? In der Kindheit erschien er unerreichbar, gross und fern, unantastbar und fremd, merkwürdig heldenhaft-heilig, ja gottähnlich. Angetastet wurde das Gottähnliche, wenngleich mit Herzklopfen, schon in den Kinderjahren durch Fragen, die offen blieben. Was „Vater“ in seiner Unerreichbarkeit bedeutete, das deckte sich mit „Vater“ in den Gebeten, Gottvater, Vater, die von Erwachsenen ausgesprochen wurden. Wer war gemeint? Wie waren die gleichen „Vater“worte zu verstehen? Ehrfurcht war gefordert, doch warum? Es gab in der Kindheit auf meine Fragen nur die eine Antwort: „Weil es so ist“. Durfte somit nicht hinterfragbar sein, was nicht erreichbar war? Doch was als Gebot erklärt wurde, war das Gebot zu glauben. Kein Gebot konnte Neugier und Wissenshunger stillen. Was bedeuteten Worte? Wie viel Zweifel an Worten war erlaubt?
Wichtig schien mir, ob der unbefriedigenden Antworten mein Fragen nicht verstummen zu lassen. Auch dies war leicht. Gewissensbisse bauten sich auf, sie mussten ertragen werden, ein merkwürdiges Wagnis. Die Ursachen leuchteten nicht ein, die Folgen – vage Androhungen – ebenso wenig.
Was mit dem Kindheitsempfinden einhergegangen war, liess sich in der Gymnasiumszeit mit Erstaunen teilweise erklären, als die Bedeutung des griechischen „hieros“ und ebenso jene von „arche“ zum Lernprogramm gehörten und die Bedeutung der väterlichen Hierarchie – der väterlichen und noch immer gottväterlichen Herrschaft – im Wortkleid durchschaubar wurde, wenngleich in ihrem Inhalt noch lange nicht aufhebbar war.
In den Kinderjahren gehörte die Unerreichbarkeit des Vaters und gleichzeitig die nächste Nähe, die er im Familiensystem bedeutete, zu einer der grossen Widersprüche, in welche auch die Mutter einbezogen wurde. Gefährdet erschien mir ständig das Leben des Vaters, allein schützbar durch die medizinischen Wundermittel der Mutter (Pillen und Einlagen, seltsame Wasser, tropfenweise, separate Mahlzeiten, mittags täglich psst-Ruhe) und durch ihre Bezeichnung „mon chou“, die allein dem Vater galt, auch durch die geheimnisvollen Gerüche, die am frühen Morgen beim Öffnen der elterlichen Schlafzimmertür in den Korridor des oberen Stockwerks drangen. Doch worin lag das Geheimnis, das in sich Gefährdung und Macht – ja Allmacht – verband? Bestand auch zwischen Mutter und Vater, wie ich vermutete, ein „weil es so ist“? – letztlich eine andere nicht hinterfragbare Unerreichbarkeit? Was ich in den Frauengesprächen im litaneimässig täglich wiederholten „mon mari, mon mari“… mithörte, ging mit diesem Geheimnis einher, das ich selber zu klären versuchte.
Ich erinnere mich, wie mir schien, dass die verschiedenen Sprachen mit den Worten auf ungleiche Weise verhüllten oder enthüllten, was gesagt wurde, dass auf jeden Fall in Deutsch deutlicher zum Ausdruck kam, was für die Mutter und für mich als Tochter – vielleicht – das gemeinsam Unerreichbare war. Es war etwas, das mit der Silbe „at“ zusammenhing, dachte ich, die sich sowohl in Gatte wie in Vater findet. Doch diese Silbe war noch in vielen anderen Worten, und so schien mir wichtig, mir die Worte zu merken, um mögliche Erklärungen zu finden: zu Gatte fiel mir Gatter ein, auch hier im Zentrum das „at“ wie in Vater und in Pater – in der Kindheit Männer in schwarzen Röcken -, ebenso in katholisch, in Natur und Nation, in Matrose und Matratze, doch auch in tatsächlich und satt, ebenso im französischen attention-attention und in den fremden Worten, die mir mit „at“ einfielen, etwa in Atlas und Athlet, Atmosphäre, Attrape und in vielen mehr, es waren zu viele Worte, die ich hörte beim Erlauschen von Erwachsenengesprächen (etwa die nächtlichen, kaum verständlichen des Vaters mit anderen Männern hinter der geschlossenen Tür des Herrenzimmers, es war Kriegszeit) und die Worte, die mir begegneten im Büchergestell und die ich hörte am Radio.
Ich las sehr früh und hatte als Älteste von sieben Kindern auch früh schon Pflichten zu erfüllen. Wenn ich unterwegs war vom Haus am Waldrand den Hügel hinunter, einer grauen Fabrik entlang, über den Fluss zur Apotheke, oder dem Fluss entlang in die Stadt zum Nähgeschäft, oder einen anderen Hügel hinauf zum Gemeindehaus mit dem Schalter, durch welchen die Lebensmittelmarken ausgehändigt wurden, so gingen die Worte wie Übersetzungsübungen im Takt meiner Kinderschritte einher. Oft schien mir, wäre ich ein Knabe gewesen wie der bei der Geburt verstorbene Erstgeborene, den ich abgelöst hatte, so hätte ich zum Beispiel die Tür von Vaters Herrenzimmer öffnen und wissen dürfen. Warum war Wissen mir als Tochter mit Verboten verbunden? Wie konnte ich das Gatter übersteigen?
Beinah wortlos und trotzdem näher erschien mir der Vater des Vaters, zurückversetzt hinter seinen Sohn, machtlos und trotzdem nicht ohnmächtig. Keine Ähnlichkeit bestand zwischen ihnen. Eine lange Reise war erfordert, um die örtliche Distanz zu überwinden. Bei den väterlichen Grosseltern verbrachte ich viele Kindheitswochen. Frühmorgens vor Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang, wenn meine Schlafzeit begann im kleinen Hinterhofraum, der angehängt war ans Schlafzimmer der Grosseltern, sprach der Grossvater seufzend immer das gleiche Gebet wie ein Kindergedicht, mehr nicht. Fähig war er, wilde Bäume in fruchttragende Bäume zu verwandeln, in ruhigem Rhythmus schnitt er Gras und Korn, stand sicher auf hohen Leitern und pflückte Kirschen oder Mirabellen und Birnen, die nirgendwo besser gediehen als unter seiner Hand. Unter den schönsten Bäumen hatte er eine Bank gebaut. Auf dieser Bank neben ihm wortlos zu sitzen und über die Baumkronen und Wiesen hinweg in die hügelige Weite des Elsass zu blicken, löste ein nicht benennbares Gefühl aus, vielleicht ein Glücksgefühl, ein Gefühl von Zeitlosigkeit.
Meine Neugier im alten Haus der Grosseltern war anders als im Haus von Vater und Mutter, bezog sich nicht auf deren Schlafzimmer und kaum auf den Keller mit dem Eingemachten und dem Sauerkohl, sondern stärker auf den Hühnerhof und die Eier, am stärksten jedoch auf den Estrich unter dem hohen Dachfirst, wo neben Jutesäcken mit Nüssen, Kartoffeln und Korn auch Alben mit Photos und Schachteln voller Postkarten lagen. Es schwebte ein Duft von Erde und von Geschichte in diesem dunkeln Raum mit den winzigen Fenstern. Wer hatte wem was von wo geschrieben? Konnte ich über den Estrich des Grossvaters dem vielen Unbekannten, das meinen Vater einhüllte, näher kommen?
Erkundungshunger und Wissensdurst hatten hohe Preise: schrittweise Erfahrungen, ständige Neugier und Sehnsucht, Denkanstösse und Enttäuschungen, das Glück und das Gewicht wachsender Verantwortung, dunkle Zeiten, helle Momente. Die sokratische Bedeutung von „eros“ ging mit allem Erkunden einher, geht weiter damit einher. Spät im Leben, nach dem plötzlichen Tod der Mutter, waren Auseinandersetzungen mit dem alten Vater möglich. Die innere Freiheit war erstarkt. Das Gewesene und Vergangene war wohl noch zu benennen und zu erfragen, doch gleichzeitig zu akzeptieren. Und das Gegenwärtige und Zukünftige? – es war von seiner Seite her nicht mehr zu gebieten noch zu verbieten, sondern ebenfalls zu akzeptieren. Eine Gleichheit im Wagnis des Nichtwissens? Von Vaters Seite her unmöglich, da er des allmächtig wissenden und strafenden, göttlichen Jenseitsvaters in einer nicht hinterfragbaren Sicherheit des Glaubens bedurfte; meinerseits möglich als Hoffnung – eine Neugier im Zeitlosen -, die sich mit dem Denkkonstrukt von Raum und Zeit als Methode der Lebensordnung weder beschränken noch verwirren liess, schon lange nicht mehr.
War ich vaterlos geworden? Das war nicht möglich, auch nicht nach dem Tod des Vaters. Ein vaterloses Wesen würde zum Konstrukt.
Die Erkundungssuche nach den Vatergeschichten und Muttergeschichten setzte sich fort. Es ist eine transgenerationelle Geschichte, in welche hinein wir versetzt wurden und mit welcher wir vernetzt bleiben. Mit zunehmender Gewissheit verdeutlichte sich die geheimnisvolle Kraft des Lebens als tragende Verbindung zwischen dem eigenen Erdendasein und jenem der Kinder und Grosskinder wie jenem der dahingegangen Generationen und den völkerweiten, zwischenmenschlichen Verbindungen. In ihrer grossen, doppelgeschlechtlichen Bedeutung sowohl im körperlich wie geistig Kreativen ist es die Wirkungskraft von Empfinden, Denken und Tun, von Bedürfnissen und Zielsetzungen, die die gemeinsame Erbschaft bedeutet. Ob ihr ein Testament vorausging, wird von Religionen und Ideologien unterschiedlich erklärt und von einzelnen Menschen im Rekurs auf ihre innere Freiheit unterschiedlich gedeutet, als Glaube und Glaubensverpflichtung oder als Wagnis des Nichtwissens und des je eigenen, suchenden Gestaltens, auch als schwierige und häufig leidvolle Arbeit wie noch das letzte Gespräch mit meinem alten Vater verdeutlichte. Und wie damals stellt sich erneut die Frage, was in Frage gestellt werden darf.
Wir beginnen mit den Aussagen väterlicher Erbschaft aus der Urzeitgeschichte, wie sie vor rund achttausend oder sechstausend Jahren aufgezeichnet, immer wieder nacherzählt und nachgezeichnet wurden, bis zu den jüngsten Übersetzungen, aus welchen ich die mehrmals neu bearbeitete Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig auswählte[1]:
„ER, Gott, sprach: Da, der Mensch ist geworden wie einer im Erkennen von Gut und Böse.
Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen und in Weltzeit leben. (…)
Der Mensch erkannte Chawwa sein Weib, sie wurde schwanger, und sie gebar den Kajin. Da sprach sie: Kaniti – erworben habe ich mit IHM einen Mann. Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Habel. (…)
Nach Verlauf der Tage wars, Kajin brachte von der Frucht des Ackers IHM eine Spende, und auch Habel brachte von den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett.
ER achtete auf Habel und seine Spende, auf Kajin und seine Spende achtete er nicht.
Da entflammte Kajin sehr, und sein Antlitz fiel.
ER sprach zu Kajin: Warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist es nicht so: meinst du Gutes, trags hoch, meinst du nichts Gutes aber: vorm Einlass Sünde, ein Lagerer, nach dir seine Begier – du aber walte ihm ob.
Kajin sprach zu Habel, seinem Bruder. Aber dann wars, als sie auf dem Felde waren: Kajin stand auf wider Habel seinen Bruder und tötete ihn. (…)
Und ER legte Kajin ein Zeichen an, dass ihn unerschlagen lasse, allwer ihn fände.
Kajin zog von SEINEM Antlitz hinweg und er wurde sesshaft in Lande Nod, Schweife, östlich von Eden.
Kajin erkannte sein Weib, sie wurde schwanger und gebar den Chanoch. (…)
Dem Chanoch wurde Irad geboren,
Irad zeugte Mechujael,
Mechujael zeugte Metuschael,
Metuschael zeugte Lamech.
Lamech nahm sich zwei Weiber, der Name der einen war Ada, der Name der zweiten Zilla.
Ada gebar den Jabal, der wurde Besitzer von Zelt und Herde.
Der Name seines Bruder war Jubal, der wurde Vater aller Spieler auf Harfe und Flöte.
Und auch Zilla gebar, den Tubal-Kajin, Schärfer allerlei Schneide aus Erz und Eisen.
Tubal-Kajins Schwestr war Naama.
Lamech sprach zu seinen Weibern: Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, Weiber Lamechs , lauscht meinem Spruch: Ja, einen Mann töt ich auf eine Wunde, und einen Knaben für eine Strieme!
Ja, siebenfach wird Kajin geahndet, aber siebenundsiebzigfach Lamech!
Adam erkannte nochmals sein Weib, und sie gebar einen Sohn.
Sie rief seinen Namen: Schet, Setzling! (…)
Auch Schet wurde ein Sohn geboren, er rief seinen Namen Enosch, Menschlein.
Damals begann man den NAMEN auszurufen..
Dies ist die Urkunde der Zeugungen Adams, des Menschen. (…)
Als Adam hundertunddreissig Jahre gelebt hatte, zeugte er in seinem Gleichnis nach seinem Bild und rief ihn mit dem Namen Schet. (…)
Als Schet hundert und fünf Jahre gelebt hatte, zeugte er Enosch. (…)
Als Enosch neunzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Kenan. (…)
Als Kenan siebzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Mahhalalel. (…)
Als Mahalalel sechzig und fünf Jahre lebet hatte, zeugte er Jared. (…)
Als Jared hundert und zweiundsechzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Chanoch. (…)
Als Chanoch fünfundsechzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Metuschalach. (…)
Als Metuschalach hundert und siebenundachtzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Lamech. (…)
Als Lamech hundert und zweiundachtzig Jahre gelebt hatte, zeugte er einen Sohn.
Er rief seinen Namen: Noach! – sprechend „Se jenachmenu“ – Dieser wird uns leidtrösten
In unserem Tun und der Beschwernis unserer Hände an dem Acker, den ER verflucht hat.
Und nach Noachs Erzeugung lebte Lamech fünfhundert und fünfundneunzig Jahre,
er zeugte Söhne und Töchter. (…)
Als Noach fünfhundert Jahre alt war,
zeugte Noach den Schem, den Cham und den Jafet. (…).“
In der Folge der Urkatastrophe, jener Überflutung der Erde als Strafe für die Bosheit der Menschen, welche allein Noach und seine Sippe sowie je ein Paar aller animalischen und pflanzlichen Geschöpfe überlebten, geht die Geschichte als Zeugungsgeschichte der Söhne und deren Söhne weiter, deren Namen die Seiten füllen, bis zu Tarach, einem der Sprösslinge Schems, der als ersten Sohn Abram zeugte. Und auch mit ihm geht die Geschichte der Söhne und deren Frauen und der Mägde der Frauen weiter, die immer nur Erwähnung finden, wenn sie Söhne gebären, die als gute oder als böse Stammesväter weiter die Geschichte fortsetzten, bis zu Jaakob, einem der Söhne Jizchaks, mit seinen zwölf Söhnen, die ihm die Töchter Labans, seine zwei Frauen – Lea und deren Magd Bilha sowie Rachel und deren Magd Silpa – geboren hatten, weiter zur Geschichte dieser Söhne, die sich unter einander verfeindeten, da sie von ihrem Vater sich ungleich geliebt fühlten, sodass einer der Söhne Rahels, Joszef, von den Brüdern in einen Brunnen versenkt wurde, der aber von Händlern aus Midjan gefunden, aus dem Loch herausgeholt und an Pozifar, einen Höfling des ägyptischen Pharao, verkauft wurde, ja, mit der Folge der Geschichte Joszefs und seiner Brüder, insbesondere jenes von Binijamin, denen er ermöglichte, über Generationen in Ägypten zu leben und stark zu werden, bis der ägyptische Pharao dieses sich bei ihm vermehrende, von Jaakovs Sohn Joszef und dessen Brüdern abstammende „ebräische“ Volk als Bedrohung empfand und deren Geburtshelferinnen gebot, allein die Töchter am Leben zu lassen und die Söhne zu töten. Da diese sich nicht an das Gebot hielten und es wagten, auch die Söhne am Leben zu lassen, wurde einer der Söhne, der im Schilf in einem Kästlein aus Papyrusrohr versteckt und von einer Magd von Pharaos Tochter gefunden wurde, von dieser gerettet und Moshe genannt, „der hervortauchen lässt“[2].
Die Fortsetzung der Jakob-Josef-Moses-Geschichte ist die Fortsetzung väterlicher Erbschaft, es ist die jüdisch-christliche Geschichte von Söhnen und Vätern, die in die Jesusgeschichte hineinreicht und weiter- und weiterreicht. Mit dieser Geschichte einher gingen grosse hierarchische Konflikte, neue Religionen, von Hass und Rache geprägt Kriege, kollektive Sehnsüchte, Familiengeschichten. Ebenso entstand daraus die versengende Suche nach Wahrheit, die Aussenseitertum und „Enterbung“ bewirkte. Findet sich hier eine Deutungsmöglichkeit für den anwachsenden Mythos der geheimnisvollen, göttlichen Herkunft Jesu als Ewigen Sohn, dem die menschliche Vaterschaft abgesprochen wurde, von seiner Mutter „jungfräulich empfangen“ und so auch der eigenen Vaterschaft entmündigt? Jesu Aufbegehren gegen hierarchische Macht und Gewalt, sein offenes, furchtloses Eintreten für gleichen menschlichen Lebenswert und gleiches Recht auf Respekt, ja auf Liebe, unabhängig von Herkunft und Geschlecht, bewegte Massen von Menschen und entsetzte die rabbinische Herrschaft ebenso wie die römische Besetzungsmacht. Gefangennahme, Folter und Tötung, deren Nachwirkungen mit nicht endender Anhänglichkeit und Trauer sowie mit nicht endender Fortsetzung von Rache bis heute andauern, stellen neue Fragen. Wurde Jesus dadurch zum zeitlosen geheimen Bruder oder Geliebten? – auch zu einem geheimen Vater, einem anderen Vater? – einem göttlichen Wahlvater? Setzte sich über Jahrhunderte fort, was durch die Erzählungen und Berichte der ersten Anhänger, Freunde und Freundinnen einerseits zu einer Verpflichtung der Treue wurde, andererseits für ein neues, hierarchisch patriarchales Ordnungsgefüge benutzt wurde? Wie verbinden sich die Fragen mit der Gestalt von Moses? Lassen sich mit Moses die Fragen bezüglich der Herkunftsväter verknüpfen und mit Jesus jene bezüglich der Wahlväter, Fragen, die seit Jahrhunderten sowohl mit tiefen Sehnsüchten wie mit einem mächtigen Verbot, sie zu berühren – mit einem Tabu – verbunden waren?[3]
Als Sigmund Freud bereit war, Moses’ Herkunftsgeschichte aus dem Tabu zu befreien, ihn mit analytischer Akribie von der hebräischen Vaterschaft zu lösen und ihn der ägyptischen zuzuordnen, stand er selber dem Tode nahe [4], in seiner persönlichen Vaterschaft geliebt, vielfach bewundert und angefeindet – sowohl der genetischen, innerfamiliären, für die drei Söhne und drei Töchter aus der Ehe mit Martha Bernays nicht wählbaren Vaterschaft wie der emotional vielschichtigen, von seinen Schülern und Nachfolgerinnen selber gewählten. Die Fragen rings um die Bedeutung des „Tabu“ hatte er über dreissig Jahre vorher aufgegriffen[5], jedoch nicht gewagt, das religiöse Tabu, dieses „uralte Verbot, von aussen (von einer Autorität) aufgedrängt und gegen die stärksten Gelüste des Menschen gerichtet“, durch kritisches Hinterfragen der verdrängten und neu überlieferten, übertuschten Zusammenhänge um die Moses-Geschichte offen zu berühren. Am nächsten stand ihm damals nicht Martha, seine Frau, sondern seine „Antigone“, die jüngste Tochter Anna, die den Vater mit seinen körperlichen Leidensbelastungen zu entlasten trachtete und die die väterliche Erbschaft teilweise mit den ihr zustehenden Wahlmöglichkeiten, jedoch in erster Linie mit einem verpflichtenden Testament verband; ferner einige der wenigen Wahlbrüder oder Wahlsöhne, die sich nicht gegen den mächtigen, mosesähnlichen „Vater“ erhoben hatten wie die meisten in der „Urhorde“ der „Wiener Vereinigung“ der Psychoanalyse[6], etwa Ludwig Binswanger und Oskar Pfister in Zürich sowie Karl Abraham und Ernest Jones als seine loyalen Nachfolger in Wien resp. in Kanada. Arnold Zweig, der ihn als „geliebten Vater“ ansprach und mit welchem Freud vor allem in der Endfassung seiner Moses-Bearbeitung einen nahen Austausch hatte, verdeutlicht die Entstehungszusammenhänge einer Wahlvaterschaft in deren Dringlichkeit und Brüchigkeit. Wir werden darauf eingehen.
Die mosaische Vatergeschichte sowie in der Fortsetzung und religiösen Abspaltung die auf Jesus bezogene Geschichte der göttlichen Vaterschaft, damit der Abwendung von der menschlichen Vaterschaft, die damit verbundene Ferne und Vergeistigung der väterlichen Zugehörigkeit, die Vaterlosigkeit oder die geheime Vaterschaft und Wahlvaterschaft gehören mit dem Tabu gegenüber deren Erbschaft zu den kulturellen Beständen, welche die Entwicklung unserer Hemisphäre beherrschten – und weiter beherrschen. Eine der grossen Differenzen zwischen den jüdischen und den christlichen besteht in der einerseits genetisch, andererseits glaubensmässig begründeten Nichtantastbarkeit der Herkunftsgeschichte. Zwar war während Jahrhunderten, unabhängig von Herkunft- und Religionszugehörigkeit, letztlich allein die mütterliche Herkunft eine Sicherheit – „mater semper certa est“ -, während für die Vaterschaft die Namensbestätigung erfordert war resp. noch immer ist. Doch trotz aller kulturellen und technischen Fortschritte – bis zu den DNA-Überprüfungen – bleiben die Fragen der Identität und des persönlichen Wertes jedes Menschen mit den Mutter- und Vatergeschichten verbunden, ob sie bekannt seien oder nicht.
Letztlich war die patriarchale Macht, welche die ganze westliche Geschichte prägte, auf der in allen drei monotheistischen Religionen verankerten männlichen Zeugungs- und Schöpfungspotenz aufgebaut, die als göttliche Allmacht und Weltherrschaft verstanden wurde. Die tragende matriarchale Kraft blieb eine verborgene und verehrte, jedoch machtlose. Auch die zunehmende Vergeistigung des Gottesbegriffs, die sich durch das Bild- und Benennungsverbot in der jüdischen wie in der islamischen Religion verdeutlichte, veränderte in keiner Weise das Gewicht irdischer Patriarchalität, bei welcher die sexuelle Potenz ebenso als Herrschaftsbegründung erklärt wurde wie die geistige Schöpfungsmacht. Während in der im Alten Testament resp. in der Tora verankerten Mythologien („my“ – idg. Ton) die Gebärkraft und Fürsorge der Mütter wie auch die vielseitige Begabtheit, der Mut und die Klugheit der Töchter erst hinter der Benennung der Vaterschaft sowie der Söhne eine Beachtung finden, hatte sich im frühesten monotheistischen Religionssystem des ägyptischen Pharao Echnaton resp. Amenhotep IV (um 1350 vor Chr.) mit der Erklärung der Sonnenscheibe Aton als dem alleinigen Gott die Verbindung und Gleichwertigkeit des Männlichen und Weiblichen während kurzer Zeit als kulturelle Revolution durchgesetzt.[7] Dass Nofretete, der Grossen königlichen Gemahlin und ihren sechs Töchtern, der Vollzug der religiösen Handlungen zugesprochen wurde, dass gleichzeitig die Vielzahl der für das Volk wichtigen Götterverehrung auf brutale Weise verboten wurde, erregte Aufsehen, Erschrecken und Widerstand. Als Echnaton 1334 v. Chr. starb, wurde alles, was während seiner 17 Jahre dauernden Herrschaft mit dem neuen religiösen und politischen System verbunden war, aufgehoben, vernichtet und verdrängt[8].
Weder vernichtet noch verdrängt werden konnte die monotheistische Gottvorstellung, die mit Moses und der aus Ägypten emigrierenden hebräischen Bevölkerung in die jüdische sowie später in die christliche und islamische übertragen wurde. Es ist eine merkwürdige Verdoppelung mythologischer Erbschaft, die in den drei Religionen erhalten blieb, einerseits die mit dem Aton-Glauben verknüpfte Eingottherrschaft, die in der jüdischen Religion zur Vaterreligion und in der christlichen zur Sohnesreligion wurde, während die islamische die Fortsetzung von Vater und Sohn in der Gotterklärung übernahm, andererseits die mit dem menschlichen Bedürfnis nach mystischem Geheimnis und nach Wundern verbundenen Ausmass an Bedingungen und Bestimmungen, an Geboten und Verboten, an Ritualen und Gebeten, denen sich Millionen von Gläubigen unterwarfen und weiter unterwerfen.
Verborgene Teile der mit dem Monotheismus verdrängten Aspekte der animalischen, weiblichen und männlichen Fülle göttlicher Kraft, die in der griechischen, ja schon in der vorgriechischen, minoischen Mythologie wie in der römischen und in zahlreichen anderen Ursprungsgeschichten menschlichen Lebens ihren Platz und ihre Bedeutung hatten[9], beeinflussen weiter die religiösen, die sozialen und politischen Systeme unserer Geschichte, mit allen Folgen von Verdrängung, die sich in Ängsten, in Hassgefühlen und Feindvorstellungen, in Flucht- oder Ersatzbedürfnissen äussern.
Dass in erster Linie die gottähnliche Macht der „Väter“ sich fortsetzte, mit Eifersucht vor der wachsenden Männlichkeit der Söhne und mit Schuldgefühlen der Söhne gegenüber den eigenen Vätern, denen sie nicht genügen konnten oder deren Tod sie herbeiwünschten (oder verursachten, wie es Moses durch sein Volk geschah[10]), hat sich in den Religionen wie in den staatlichen Systemen wie in den Familien fortgesetzt. Sigmund Freuds „ansprechende Vermutung“ ist beachtenswert, „dass die Reue um den Mord an Moses den Antrieb zur Wunschphantasie vom Messias gab, der wiederkommen und seinem Volk die Erlösung und die versprochene Weltherrschaft bringen sollte. Wenn Moses dieser erste Messias war, dann ist Christus sein Ersatzmann und Nachfolger geworden, dann konnte auch Paulus (ein römischer Jude aus Tarsus) den Völkern zurufen: ‚Sehet, der Messias ist wirklich gekommen, er ist ja vor unsern Augen hingemordet worden.’ Dann ist auch die Auferstehung Christi ein Stück historischer Wahrheit, denn er war (der auferstandene Moses und hinter ihm) der wiedergekehrte Urvater der primitiven Horde, verklärt und als Sohn an die Stelle des Vaters gerückt.“[11]
Auf die persönliche Auseinandersetzung Freuds mit seinem Vater und dessen väterlicher Erbschaft wie auf ihn in seiner vielfachen, im Lauf der Lebensgeschichte sich verändernden Vaterfunktion mit allem Machtanspruch und allen Ängsten werden wir in der 2. Vorlesung eingehen.
Vaterschaften und Wahlvaterschaften – Sohnesgeschichten: Sigmund Freud
2. Vorlesung
In allen Mythologien ist die grosse Geschichte schöpferischer und zerstörerischer Geschehnisse Folge zugleich göttlichen und animalischen Handelns, das sich im Menschsein sowohl verkörpert wie vergeistigt – und fortsetzt. Dass in Zusammenhang der monotheistischen Religionen die zwei sich ergänzenden Geschlechter – das männliche und das weibliche – in ungleiche Machtverhältnisse gerieten, durch welche die väterliche Herkunft während Jahrhunderten als jene der Zeugung zu jener der Namengebung wurde und von überwiegender Bedeutung bezüglich Herrschaft, Besitz und/oder Zugehörigkeit war, das wirkte sich in den privaten, innerfamiliären Verhältnissen ebenso aus wie in den öffentlichen Strukturen – bis in die heutige Zeit, jeglicher Aufklärung und Emanzipation zum Trotz. Der Machtkampf zwischen Vater und Sohn wie zwischen den Brüdern um den Platz der Herrschaft hat sich in unendlichen Variationen wiederholt, wie schon erwähnt auch unter den Nachfolgern Freuds. Ohne Zweifel geht die Frage der Deutung des archaisch-testamentarischen Imperativs „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“ -, wie J. W. Goethe ihn in Faust I formuliert hat, mit jener der persönlichen Wahlmöglichkeiten einher, die im Verhältnis zur nicht wählbaren Herkunftsgeschichte – Familiengeschichte, Stammbaum, Abkunft und Name – dem Menschen zustehen.
Doch was heisst in Zusammenhang väterlicher Herkunft „erben, erwerben und besitzen“? Geht es um die Art der Fortsetzung des väterlichen Namens oder der familiären Geschichte? – oder geht es um die Übernahme und Verstärkung dessen, was die Macht des Vaters ausmachte: Nähe zur Mutter, Herrschaft über untergeordnete Menschen, z.B. über „schwächere“ oder jüngere Brüder, über Schwestern, über Angestellte, Lehrlinge, Schüler und Schülerinnen, letztlich über ein Volk? – geht es um materiellen Besitz, um Boden und Vieh resp. Geld und Aktien? Geht es letztlich um Übernahme und Erneuerung väterlicher Potenz in der ganzen Bedeutung? Die Art der Vatererfahrung und des daraus wachsenden Vaterbildes entspricht einer Vielzahl von Abhängigkeitstatsachen, von deren missbräuchlichen Ausnutzung über verantwortungsbewusste Sorgfalt bis zur Ausweitung individueller Macht oder Ohnmacht in kollektive Unterwerfungsforderung oder Anpassung.
Allein in den Wochen der Vorbereitung dieses Semesters fanden sich in Literatur und Tagespresse sowie in den therapeutischen Sitzungen und in anderen Gesprächen Vaterbenennungen in allen Variationen vor, die ich zu notieren begann: „verehrter, liebster Vater Freud“ (Arnold Zweig, Anrede im Briefwechsel), „liebster Vater „ (Franz Kafka, Anrede im Brief an den Vater), väterliche Macht/väterliche Gewalt/väterlicher Drill (Gespräche), oh mein Papa (Gespräch mit junger Frau, in trällernder Nachahmung von Lys Assia), Vater-Vati-Papi-Daddy–Grossvater/Grossväter/Urgrossväter (Gespräche), „am Gängelband des Patriarchen“ (betr. Goethes Sohn August, NZZ 9./10. 6. 07), „Ersatzvater“ (betr. Religion, NZZ, 12.6.07), allmächtiger Vater/unser Vater/Vater unser/Pater noster/Pater Franz/Heiliger Vater (religiöse Assoziationen in Gesprächen), „unmässige Vaterliebe“ (betr. King Lear, NZZ, 1.6.07, S. 45), „Vaterkönig, schuldlos-schuldig, der die tragische Fallhöhe garantiert“ (betr. Lucia Joyce / James Joyce, NZZ, 7./8. 7. 07), „Gründungsvater der abendländischen Philosophie“ (betr. Platon / Richard Rorty, NZZ, 12. Juni 07), „Vater von Konzeptkunst“ (betr. Sol le Witt, NZZ, 10. 4. 07), „Vater der modernen Kunstkritik“ (betr. Pietro Aretino, NZZ, 14./15. 4. 07), Landesvater/Vater aller Völker (betr. Stalin und Putin, NZZ, 14. 6. 07) etc. etc.
Bei allen Benennungen geht es um Beziehungsaspekte von persönlicher und intimer oder kollektiver, allgemeiner Bedeutung, es geht um einen persönlichen Vater, um den fehlenden Vater, den angsteinflössenden und strafenden Vater, um den Vater als Beschützer und Erzieher, um den Vater als mächtigen Richter, um Väter und Söhne, Väter und Töchter, biblische Urväter, griechische Götterväter, Väter als Inzesttäter, Väter als Sohnesmörder, Väter als Lehrmeister, Väter als Firmenchefs, Väter als Staatschefs, Väter in Zeitungsartikeln, Väter in Treppenhausgesprächen, etc. etc.
Selten kommt es vor, dass der einfache, machtlose und doch starke Vater, wie er in Salvatore Quasimodo’s Erinnerungsgedicht erscheint, lange nach dessen Tod in einem zu Lebenszeiten nicht benennbaren Wert geehrt wird:
„(…) Deine traurige, zarte
Geduld nahm uns die Angst
War Lehre von Tagen, zu denen gehörte
der betrogene Tod, die Verhöhnung der Diebe,
gefangen in den Trümmern und im Dunkel gerichtet
vom Gewehrfeuer der Gelandeten, eine Rechnung
niedriger Zahlen, die genau konzentrisch
aufging, eine Bilanz zukünftigen Lebens.
Deine Sonnenmütze ging auf und ab
in dem geringen Raum, den sie dir immer gaben.
Auch mir massen sie alles zu,
und ich habe deinen Namen ein wenig weiter
getragen, über Hass und Neid hinaus.
(…)
Und jetzt im Adler deiner neunzig Jahre
wollt ich sprechen mit dir, mit deinen bunten
Abfahrtssignalen aus der Nachtlaterne,
und hier, aus einem mangelhaften
Rad der Welt, auf einer Menge dicht gedrängter Mauern,
weit fort vom arabischen Jasmin,
bei dem du noch bist, um dir zu sagen,
was ich früher nicht sagen konnte
– schwierige Gedankenverwandtschaft –
um dir zu sagen, und es hören uns nicht nur
die Zikaden am Scheideweg, die Mastixagaven,
wie der Feldhüter sagt zu seinem Herrn:
‚Wir küssen die Hände.’ Dies, nichts anderes.
Geheimnisvoll stark ist das Leben.“[12]
Noch seltener lässt sich persönliche Bescheidenheit eines Vaters vernehmen, indem er dem Kind zu verstehen gibt, es möge besser sich von seinem Erbe abwenden und das eigene Leben leben. Nicht an einen Sohn, sondern an eine Tochter richtet sich der Rat „Horch nicht auf mich“, auch die Erklärung, dass „keiner keinem ein Erbe sein kann“. Stehen Töchtern grössere Wahlmöglichkeiten als Söhnen zu?
„Schlaf, mein Kind – schlaf, es ist spät! Schlaf mein Kind – der Abendwind
weht.
Sieh wie die Sonne zur Ruhe dort geht. Weiss man, woher er kommt, wohin er
geht?
Hinter den Bergen stirbt sie im Rot. Dunkel, verborgen die Wege hier sind,
Du – du weißt nichts von Sonne und Tod, Dir, auch mir, und uns allen, mein
Kind!
Wendest die Augen zum Licht und zum Schein – Blind –so gehen wir und gehen allein,
Schlaf, es sind soviel Sonnen noch dein, Keiner kann Keinem Gefährte hier sein
Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein. Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf
ein!
Schlaf mein Kind und horch nicht auf mich! Schläfst du, Mirjam? – Mirjam, mein
Kind,
Sinn hat’s für mich nur, und Schall ist’s für dich. Ufer nur sind wir, und tief in uns
rinnt
Schall nur, wie Windeswehn, Wassergerinn, Blut von Gewesenen – zu Kommenden
rollt’s,
Worte – vielleicht eines Lebens Gewinn! Blut unserer Väter, voll Unruh und
Stolz.
Was ich gewonnen grabt mit mir ein, In uns sind Alle. Wer fühlt sich allein?
keiner kann Keinem ein Erbe hier sein – Du bist ihr Leben – ihr Leben ist
dein—
Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein! Mirjam, mein Leben, mein Kind –
schlaf ein![13]
Was im vergangenen Semester mit der Untersuchung des „anderen Genies“ die Entwicklungsgeschichte von Frauen betraf, was auch in deren Vaterbeziehung und in deren Mut, sich aus Herkunftszwängen zu lösen, als Umsetzung kreativer Freiheit gedeutet werden konnte, lässt sich nicht generalisieren. Trotzdem ist es zulässig zu sagen, dass dem anderen Geschlecht hinsichtlich des väterlichen Erbes andere Möglichkeiten zustehen als Söhnen, die das väterliche Geschlecht fortsetzen und denen unter dem Blick des Vaters das eigene Bild übertragen wird, sei es als ungenügenden Abkömmling (Kafka), sei es als Rivalen, der zum Opfer oder zum überlegenen, überlebenden Sieger wird, sei es als gleichberechtigter Nachkomme, der sich nicht der Machtkonkurrenz ausgesetzt fühlt und daher ihrer nicht bedarf. Dass der gleichzeitig auf den Söhnen ruhende Blick der Mütter wie auch jener der Schwestern von grossem Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbildes und späterer Beziehungen ist, zeigt sich deutlich in der Auseinandersetzung mit Freuds persönlicher Geschichte. Diese führt eine Spur weiter.
Bevor wir darauf eingehen, erscheint es mir von Interesse zu sein, unter den vielen Nebenspuren, die mit Freud verknüpft sind, einer nachzugehen, in welcher die Frage der Wahlvaterschaft näher betrachtet werden kann.
„Neunzehn Jahre, (…), ein schmaler Junge, der bald stirbt. Das ist seine Geschichte.
Sie fängt beim Vater an – alle Menschengeschicke fangen bei Vätern an.“[14]
Als Arnold Zweig[15] 1931 den Band „Knaben und Männer“ veröffentlichte, stand er seit vier Jahren im Briefaustausch mit Sigmund Freud. Erst hatte er ihn mit „Sehr geehrter Herr Professor Freud“ angesprochen und ihn demütig angefragt, ob er ihm sein Buch „Caliban oder Politik und Leidenschaft“[16] widmen dürfe; wenig später begannen die Briefe mit „Sehr verehrter und geehrter Herr Freud“, am 11. Dezember 1931 das erstemal mit „Lieber Herr und Vater Freud“, schliesslich am 16. November 1932 mit „Lieber Vater Freud“, später auch mit „Liebster, verehrter Vater Freud“. Der mit Bewunderung und Hingabe erkorene Vater akzeptierte den dreissig Jahre jüngeren Schriftsteller nach einigem Zögern. Da er jedoch nicht zu den eigentlichen „Schülern“ und nicht zur „Vereinigung“ gehörte, beanspruchte er ihm gegenüber wenig Bevormundung. Auch traten kaum Rivalisierungsängste auf. Jede Art von Gedankenaustausch wurde offen zugelassen wurde, und mit den Gedanken die Vielzahl von Empfindungen, die mit den Arbeitsprojekten, den körperlichen Beschwernissen und den für beide zunehmend schwierigeren Lebensbedingungen zusammenhingen. Freud bezeichnete ihn jedoch nicht als Sohn, sondern nannte ihn „Meister“ – „Meister Arnold“ und beendete jeden Brief mit „Ihr Freud“, gegen Ende seines Lebens mit „Ihr getreuer Freud“. Als ein Symbol, das dem geistigen Erbe von Goethes Wahlverwandtschaft entsprach, hatte er ihm aus den persönlichen Sammelobjekten erst drei griechische Goldmünzen, dann einen Ring geschenkt (Anfang September 1937) , den Arnold Zweig fortan ständig trug. Als Arnold Zweig am 4. April 1938 per Telegramm erfuhr, dass die Flucht seines „liebsten Vaters“ aus dem von der Gestapo kontrollierten Wien endlich zustande kam – „Leaving today for 39, Elsworth Road, London N.W. 3. Affect. Greetings, Freud“ -, antwortete er am selben Tag mit dem Achtzeiler, der dem ganzen Briefwechsel bei dessen Veröffentlichung vorangestellt wurde und dessen Vielschichtigkeit einen grossen Fächer an Deutungen zulässt. Er schrieb
„Dem Vater Freud:
Was ich war, bevor ich
Dir begegnet,
Steht in diesen Seiten
mannigfalt.
Welches Leben war wie
Deins gesegnet?
Welches Wissen hat wie
Deins Gewalt?“
Bevor Arnold Zweig[17] zum „sohnhaft liebenden“[18] Vertrauten Sigmund Freuds wurde, hatte er mehrere Lebensetappen durchgestanden, die ihn, wie man annehmen könnte, längst ins Erwachsenenalter katapuliert hatten. Er war 40 Jahre alt und selber Vater von zwei Söhnen, hatte den Ersten Weltkrieg an der Front durchgestanden und war als kritischer Denker und Schriftsteller zugleich erfolgreich und angefeindet, als mit der Veröffentlichung von „Caliban“ der Briefwechsel mit Sigmund Freud und damit eine zwölf Jahre dauernde Beziehung begann, die ein vielfältiges Lebensgeflecht bedeutete. Es war vier Jahre später, nach Freuds 75. Geburtstag, dass er durch die Anrede „Lieber Herr und Vater Freud“ das massgebende Bedürfnis nach einer nicht mehr lösbaren Bindung kund tat. Warum „Vater Freud“? Arnold Zweig war in diesem Brief vom 11. Dezember 1931 auf den vor zweieinhalb Jahren verstorbenen Hugo von Hofmannsthal[19] sowie auf den knapp vor zwei Monaten in Folge einer Hirnblutung plötzlich hinweggerafften Arthur Schnitzler[20] eingegangen, über dessen Tod er noch zu niemanden kein Wort habe sagen können, „denn er ähnelte meinem Vater körperlich, nur dass mein Vater ein bäurischer Jude war, und sein ‚Weg ins Freie’’ hat mir einmal mehr bedeutet als die anderen Erzeugnisse Schnitzlers und seiner Generationsgenossen.“[21]
Vieles ging mit dem Vergleich einher, sowohl die Erinnerung an den eigenen Vater und an dessen „bäuerische“, wohl erdnahe und zugleich offene Bereitschaft, ihm das eigene Leben und ein befreiendes, sich aus jeglicher Getto-Einklammerung lösendes Wachstum zu ermöglichen, wie gleichzeitig der Gedanke des Todes, waren doch Hofmannsthal und Schnitzler je 18 resp. 8 Jahre jünger gewesen als Freud und beide infolge eines plötzlichen Herzversagens gestorben. Erhoffte sich Arnold Zweig, der in der Lebensmitte war und sowohl unter seiner Myopie wie unter den politischen Entwicklungen in Deutschland litt, durch welche er sich in seiner Identität als Deutscher – als jüdischer Deutscher – ähnlich bedroht fühlte wie von einer schleichenden Krankheit, erhoffte er sich mit Freud, der seit acht Jahren – seit 1923 – eine schwere Krebserkrankung und damit einhergehende Gaumen- und Kieferoperationen zu ertragen hatte, einen dem Tod überlegenen, gottähnlichen Vater? Wünschte er sich das Recht zuzugestehen, eine neue Art Sohn zu sein, d.h. selber wieder auf kindhafte Weise geliebt und im täglich erforderten Mut unterstützt zu werden? – Brauchte er, der den eigenen zwei Söhnen gegenüber als Vorbild und Lehrmeister zu wirken hatte, jedoch immer wieder der Mutlosigkeit und schwerer Depression anheimfiel, der väterlichen Bestätigung, von analogem Wert zu sein wie er? War er sich des übergriffigen Besitzanspruchs, der mit seinen Wünschen einher ging, bewusst? Tatsächlich öffnete sich hinter Arnold Zweigs „Vater Freud“ unausgesprochen, jedoch vielfältig spürbar ein Fächer von Bedürfnissen.
Wie reagierte Freud darauf? Einerseits war er Arnold Zweig wohlgesinnt, wie er schon am 21. August 1930 zum Ausdruck brachte, als er dessen Glückwünsche zum Goethepreis, den die Stadt Frankfurt Freud zugesprochen hatte und den seine Tochter Anna an seiner Stelle entgegennahm, als die „ergreifendsten“ unter den vielen Glückwünschen bezeichnete. „Beim Durchlesen Ihrer Zeilen machte ich die Entdeckung, dass ich mich nicht viel weniger gefreut hätte, wenn man Ihnen den Preis gegeben hätte, und bei Ihnen wäre er eigentlich besser am Platz gewesen. Aber Ihnen steht gewiss viel Ähnliches bevor.“[22] Freud, der bis anhin von Arnold Zweig als „Herr Professor“ angesprochen worden war, hatte fälschlicherweise mit „Lieber Herr Doktor“ geantwortet, worauf Arnold Zweig, der trotz seines ausgedehnten Studiums keinen Doktortitel erworben hatte, beschloss, auch beim verehrten alten Freud die akademische Titelbezeichnung wegzulassen. Bedurfte er anstelle des Professors eines anderen, ebenbürtigen Titels – jenes des Vaters -, um gleichzeitig emotionale Nähe und Distanz an Wissen, auf jeden Fall Abhängigkeit zum Ausdruck zu bringen? Und wünschte Freud mit dem zwei Jahre später zugesprochenen „Meister“-Titel die Verwechslung von Arnold Zweig mit Stefan Zweig und dessen Doktortitel zu korrigieren, die er im Brief vom 10. September 1930 als „von unbekannten Mächten bewirkte Fehlleistung“ bezeichnete, die „als Störung den anderen Zweig aufzeigte (…). Er hat mir im letzten Halbjahr einen starken Grund zur Unzufriedenheit gegeben, meine ursprüngliche starke Rachsucht ist jetzt ins Unbewusste verbannt, und da ist es ganz gut möglich, dass ich einen Vergleich anstellen und eine Ersetzung durchführen wollte.“ [23] Noch beantwortete er Zweigs Briefe weiter mit dem konventionellen „Lieber Herr Zweig“, und als er am 8. Mai 1932, d.h. im fünften Jahr der Korrespondenz, nachdem Arnold Zweig sich erneut seines Geburtstags erinnert und ihm ein „beschwerdeloses Jahr“[24] gewünscht hatte, die Anrede änderte und ihn mit „Lieber Meister Arnold“ ansprach, ging er in keiner Weise mehr auf die Titel- und Personenverwechslung ein. Im darauf folgenden Brief vom 18. August des gleichen Jahres ergänzte er bloss „Ich glaube, der Name soll Ihnen bleiben“.[25] Sollte Arnold Zweig dadurch das Gefühl vermittelt werden, die „Meister“-Prüfung bestanden zu haben?
Auf jeden Fall verdichtete sich der wechselseitige Austausch an Überlegungen, an Selbstbefragung, an Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher und literarischer Arbeit, mit gesundheitlichen Problemen und Verlusten, mit den Tatsachen des anwachsenden Nationalsozialismus sowie mit der Klage Arnold Zweigs über die araberfeindliche, militarisierte und in sprachlicher Hinsicht einseitig auf Ivrit reduzierte Entwicklung des Zionismus in Palästina. Freuds Arbeit am dritten Teil des Moses, letztlich der gewagteste und klarste seiner späten persönlichen Auseinandersetzung mit der jüdischen Vatergeschichte, in die er Arnold Zweig miteinbezog, ging einher mit der zunehmenden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Dazu kam der Einmarsch Hitlers in Wien am 11. März 1938, der die Übersiedlung Sigmund und Martha Freuds sowie Anna Freuds nach London am 4. Juni 1938 mit grosser Dringlichkeit verursachte.
Schon am 2. April 1937 hatte Freud an Arnold Zweig geschrieben „Mein hereditärer Lebensanspruch[26] läuft, wie Ihnen schon bekannt, im November ab. Ich möchte gern Garantien bis dahin annehmen, aber länger möchte ich wirklich nicht verzögern, denn alles herum wird immer dunkler, drohender, und das Bewusstsein der eigenen Hilflosigkeit immer aufdringlicher.“[27] Von Seiten Arnold Zweigs wuchs die Sorge um den „liebsten Vater“ an und er teilte sie ihm mit, „denn Sie müssen daran denken, dass wir ohne Sie eine Herde ohne den Hirten sind und ein Kinderstall ohne Vater, um es biblisch auszudrücken.“[28] Im Oktober 1938 hatte Arnold Zweig es geschafft, von Haifa über Frankreich nach London zu gelangen, um seinen „liebsten Vater“ zu sehen. Doch die Begegnung war eher Bestätigung der Fremdheit als der Nähe. „Es war Ihnen gewiss anstrengend und mir schmerzlich, Ihnen so ungeordnet und überstopft gegenübertreten zu müssen. (Dieser Satz ist nicht ganz in Ordnung, also richtig). Aber ich habe es an Arbeit nicht fehlen lassen, mein Inneres besser aufzuräumen und ich werde es auch weiter tun. Und nun fühle ich beglückt, (…) dass die unablässige Urteilskraft, die Ihnen eignet, wieder an einem eigenen Schreibtisch arbeitet, (…) und dass Ihr Herz, Ihre grosse stumme Liebe, Ihr grosses stummes Leiden an unseren unselig zwiespältigen Menschen eingerahmt wird von Ihrem neuen, verjüngten Heim.“[29]
Zurück in Haifa fühlte sich Arnold Zweig zunehmend entmutigt. „Ich finde es sinnlos, weiter Werke auf so schaurigem Hintergrund loszulassen. Es ekelt einen so. Ich fürchte, das Maschinen-Zeitalter hat die Insektenseele in der Menschheit reaktiviert, und der Kulturabschliff des Krieges hat sie zur Oberfläche gebracht. Ameisen und Termiten bereiten sich vor, den Globus zu überschwemmen. Die Demokratien benehmen sich dabei wie die Blattläuse: sie lassen sich melken.[30]
Eine zunehmende Entfernung zwischen Arnold Zweig und seinem Wahlvater wurde spürbar, es war, als ob die Worte sich aus dem innern Bezug gelöst hätten, als ob die Sprache nur noch Konstrukt war. Freud erlebte eine weitere Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes, Knochenstücke wurden abgestossen, die Schmerzen nahmen ständig zu, „kein Zweifel, dass es sich um einen weiteren Vorstoss meines lieben alten Carcinoms handelt, mit dem ich seit 16 Jahren die Existenz teile“[31]. Arnold Zweig hatte in Haifa einen schweren Autounfall überstanden und erholte sich langsam. Seinem „liebsten Vater Freud“ schrieb er am 23. März 1939 „Ich bin voller Fragen an Sie über Sie selbst, aber Scham und Scheu hinderten mich bisher und werden es wohl immer tun. Die Steinach-Operation, die Karzinom-Operation, die Jahre im resistenten Wien, das Erlebnis mit Jung, mit Stekel, mit Rank: all dies sind Dinge, von denen ich mehr hören möchte.“[32]
Warum hatte Arnold Zweig nicht früher Fragen gestellt? Hatte er sich für die inneren Konflikte des „liebsten Vaters Freud“ und dessen Auseinandersetzung mit sich selbst überhaupt interessiert? Von Freud traf keine Antwort mehr ein. Das Moses-Buch war erschienen. Arnold Zweig hatte ein Exemplar erhalten und es gleich gelesen. Er hatte erwartet, dass sein „Caliban“ darin zitiert würde. Dem todkranken „liebsten Vater“ machte er aus Enttäuschung eine knappe, freche Bemerkung. „Schade, dass Sie meinen ‚Caliban’ nirgends zitieren konnten; eine bestimmte Stelle ermutigt mich zu diesem leisen Vorwurf. Zur Strafe wird Adam Ihnen eine ‚Kritik’ des Moses aus der hebräischen Zeitung der Ganz Schwarzen (Agudath Jisrael) übersetzen.“[33]
Arnold Zweig bauschte sich gegenüber dem sterbenden „liebsten Vater“ als Rächer auf und zog den eigenen jüngeren Sohn als Instrument in dieses Machtspiel hinein. Einen Monat später, im Brief vom 9. September 1939, gab er zum Ausdruck, dass ein „Übermut“ ihn „gezwickt“ habe, als er ihm schrieb, er werde ihm „zur Strafe die Übersetzung der frechsten und unsinnigsten Kritik“ schicken. Doch weder Bedauern noch Entschuldigung fügte er bei, nur dass er sich gräme, nicht Arzt geworden zu sein.
Es war der letzte Brief, den der mit sich und seiner Zugehörigkeit hadernde „Sohn“ an seinen Wahlvater richtete, dessen qualvolles Leiden er ebenso wenig ertragen konnte wie seine eigene Hilflosigkeit. Am wenigsten konnte er ertragen, in seiner eigenen Eitelkeit nicht befriedigt worden zu sein, ihm grossen, abschliessenden Moses-Werk des „geliebten Vaters“ keine Erwähnung zu finden und damit auf sich selber gestellt zu sein.
War es der Mangel an Mut, jener tragenden und wärmenden Kraft des Herzens (franz. courage – coeur), die sich bei Arnold Zweig in deren Kehrseite äusserte, in „Übermut“, die seinem triebhaften Aufbegehren nach Macht die Hand bot. Der Beziehungskreis zwischen dem aufstrebungshungrigen Schriftsteller, der der väterlichen Unterstützung bedurfte, hatte mit „Caliban“ begonnen und endete mit „Caliban“. Was Arnold Zweig als „Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitismus“ als Untersuchung kollektiver, insbesondere deutscher Notwendigkeiten der Schuldüberwälzung eigenen Versagens und Mangels an Erfolg, der Feinderklärung und Hassübertragung erarbeitet und 1927 publiziert hatte, war durch die Titelwahl „Caliban“ mit kaum kontrollierbarer, triebgesteuerter Unterwerfungshaltung sowie der Projektion aggressiver Missgunst vernetzt. In der Vorrede zum Buch findet sich der Bezug zu Shakespeare’s Patenschaft[34], jedoch auch zum ihm selbst: … „ja sein Caliban war die Verkörperung des Triebwesens und zwar meines ‚Differenzaffekts“ selbst. Caliban lebt unterhalb von Gut und Böse – ein Bursche, bemitleidenswert, auch noch in seiner bellenden Bosheit. Lust, Zorn, Hass, Rache, Angst, abergläubisches Niederfallen vor dem Fetisch und eine Menge roher Gewalt regieren ihn. Es war der Differenzaffekt, kein Zweifel, den ich in der Gruppenseele festgestellt, aus dem Unbekannten heraufgeholt und wie ein Botaniker der Seelenflora beschrieben zu haben mir bestätigte. (…) Caliban sagte genug.“[35] War Arnold Zweig selber „bemitleidenswert“? Sigmund Freud starb am 23. September 1939.
Inzwischen war der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen – am 1. September 1939 – Realität geworden.
Die von Arnold Zweig angestrebte und von Sigmund Freud nach längerer Zurückhaltung zugestandene und wahrgenommene Wahlvaterschaft wurde nach dem Tod des „liebsten Vaters“ von Zweig nicht kritisch hinterfragt; ebenso wenig beschäftigte ihn die von ihm zu spät gestellte und nicht mehr beantwortbare Frage weiter, wie Freud mit seiner eigenen väterlichen Erbschaft umgegangen war und wie er seine eigenen Vaterschaften verarbeitet hatte. Wir werden diesen Fragen nun nachgehen, wenn gleich eine Klärung aus zeitlichen Gründen nur annähernd erfolgen kann.
Sigmund Freud war 40 Jahre alt, in der Lebensmitte (etwa im gleichen Alter wie Arnold Zweig, als dieser sich erstmals an ihn wandte), seit zehn Jahren verheiratet[36] und Vater von sechs Kindern[37], Privatdozent an der Universität Wien in Neuropathologie und allmählich ein angesehener Arzt, als er dem zwei Jahre jüngeren, von ihm bewunderten Wilhelm Fliess[38] schrieb, sein alter, 81jähriger Vater befinde sich „in Baden in einem höchst wackeligen Zustand, mit Herzkollapsen, Blasenlähmung und ähnlichem. Das Lauern auf Nachrichten. Reisen zu ihm und dgl. war eigentlich das einzig Interessante dieser zwei Wochen“. Ende Juni schreibt er an Fliess, dass sein Vater „wohl auf dem letzten Bett“ liege. Er selber wird darob krank und fühlt das eigene Leben in Gefahr, „eine Influenza mit Fieber, Eiter und Herzbeschwerden hat mein Wohlbefinden plötzlich gebrochen (…). Ich möchte so gerne bis zur berühmten Altersgrenze ca. 51 aushalten“. Den Tod des Vaters vom 23. Oktober 1896 teilte er dem Freund in einem kurzen Brief drei Tage später mit und ging am 2. November 1896 näher auf die Gefühle ein, die dadurch ausgelöst wurden: „Auf irgendeinem dunkeln Weg hinter dem offiziellen Bewusstsein hat mich der Tod des Alten sehr ergriffen. Ich hatte ihn sehr geschätzt, sehr genau verstanden, und er hatte viel in meinem Leben gemacht, mit der ihm eigenen Weisheit und phantastisch leichtem Sinn. Er war lange ausgelebt, als er starb, aber im Inneren ist wohl alles Frühere bei diesem Anlass aufgewacht. Ich habe nun ein recht entwurzeltes Gefühl.“[39]
Tatsächlich beanspruchte der Tod des Vaters Sigmund Freud zutiefst seine emotionalen Kräfte. Ein Traum, den er in der Nacht nach dem Begräbnis seines Vaters hatte und den er Wilhelm Fliess im Brief vom 2. November 1896 erzählte, auch im VI. Kapitel der „Traumdeutung“ wieder aufnahm und in der Darstellung erweiterte[40], lässt einen Teil davon deutlich werden. Die Herkunftsgeschichte, d.h. das Verflochtensein mit Vater und Mutter und deren Geschichte, sowie seine eigene Entwicklung erlebte eine grundlegende Veränderung im Erkunden der Zusammenhänge. Er erkannte die Bedeutung der im Unbewussten gespeicherten Erfahrungen, die sich in einer geheimen Sprache in den Träumen äussern und der Deutung bedürfen. Freud grossartige Theorie der Traumanalyse, die er im Jahr 1900 erstmals veröffentlichte, die jedoch kaum Beachtung fand, nahm hier ihren Anfang. Im Vorwort zur zweiten Auflage der „Traumdeutung“ von 1908 hielt er fest: „In den langen Jahren meiner Arbeit an den Neurosenproblemen[41] bin ich wiederholt ins Schwanken geraten und an manchem irre geworden; dann war es immer wieder die ‚Traumdeutung’, an der ich meine Sicherheit wiederfand. (…) Auch das Material dieses Buches (…) erwies bei der Revision ein Beharrungsvermögen, das sich eingreifenden Änderungen widersetzte. Für mich hat dieses Buch nämlich noch eine andere subjektive Bedeutung, die ich erst nach seiner Beendigung verstehen konnte. Es erwies sich mir als ein Stück meiner Selbstanalyse, als meine Reaktion auf den Tod meines Vaters, als auf das bedeutsamste Ereignis, den einschneidendsten Verlust im Leben eines Mannes. Nachdem ich dies erkannt hatte, fühlte ich mich unfähig, die Spuren dieser Einwirkung zu verwischen.“[42]
Der Traum, der vermutlich in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1896 nach dem Begräbnis des Vaters folgte, handelte von einer Tafel oder einem Plakat, analog zu jenen, auf denen in den Wartesälen der Eisenbahnen das Verbot zu rauchen stand, stand mit der Inschrift:
„Man bittet, die Augen zuzudrücken
oder
Man bittet, ein Auge zuzudrücken“[43]
Freud hielt fest, dass beide Fassungen einen besondern Sinn haben: die erste bezieht sich auf die heilige Pflicht des Sohnes, die er dem verstorbenen Vater Kallaman Jacob Freud gegenüber zu erfüllen hatte und die er erfüllt hatte; die zweite auf einen Wunsch, der sich an die übrigen Familiemitgliedern richtete, ihn nicht zu bewerten, sondern Nachsicht zu üben, weil er gegen ihren Willen eine einfache Begräbnisfeier organisiert hatte und mit Verspätung dort angelangt war. Diesem Wunsch lag somit ein unbewusstes Schuldgefühl zugrunde.
Dass der Traum zugleich Gegensätzliches und Widersprüchliches an Aussagen enthielt und dass beides zutraf, war für Freud eine wichtige Erkenntnis.
Tatsächlich war er seiner Sohnespflicht dem verstorbenen Vater gegenüber gerecht geworden, der selber ihm gegenüber nachsichtig und grosszügig gewesen war, der ihm nahe stand und gleichzeitig in seiner väterlichen Bedeutung unerreichbar blieb. Unerreichbar war er durch die Anzahl von Söhnen und Töchtern, die er gezeugt hatte. Sigmund Freud, am 6. Mai 1856 unter dem Namen Sigismund Schlomo geboren (offiziell in Sigmund verkürzt, als er 22 Jahre alt war), war der Älteste von acht Kindern[44] aus der dritten Ehe seines Vaters. Da waren noch die Söhne aus der ersten Ehe des Vaters mit Sally Kanner, die nicht mehr lebte[45]: der schon verheiratete Emanuel, der ein Jahr älter und Philipp, der gleichaltrig war wie Amalia Malka Nathanson (geb. 1835), die Mutter Sigmund Freuds und seiner Geschwister, die selber 20 Jahre jünger war als ihr 40jähriger Ehemann, der Wollhändler Jacob Freud, der im mährischen Freiberg (heute tschechisch Pribor) in den ersten drei Jahren des gemeinsamen Lebens einigen Wohlstand erreichen konnte, der jedoch keine kaufmännische Begabung hatte. Er war ein grossgewachsener, nachdenklicher Mann, der „aus chassidischem Milieu stammte, (jedoch) seinen heimatlichen Beziehungen seit fast zwanzig Jahren entfremdet war“ (wie Freud 1930 an einen amerikanischen Schriftsteller schrieb, mit dessen biografischem Kommentar er unzufrieden war)[46], der zwar noch Hebräisch las, jedoch in religiöser Hinsicht so aufgeschlossen war, dass er seinen Sohn „unjüdisch erzog“, wie Freud im gleichen Brief festhielt. Zwei Wochen nach der Heirat mit Amalia kam John, der Sohn Emanuels und dessen Frau Marie, zur Welt, so dass Jacob Freud Grossvater war, noch bevor sein Sohn Sig(is)mund geboren wurde, und dieser war in den ersten drei Jahren als John’s nächster Freund und Rivale zwar neun Monate jünger als er, aber gleichzeitig sein Onkel.
Die an Tuberkulose erkrankte Mutter Freuds befand sich häufig zur Kur in Roznau, so dass noch eine Kinderfrau in den engen Haushalt beigezogen werden musste, Monika Zajic, die zur Familie des katholischen Hausbesitzers gehörte. Für den Knaben war es ein schwer durchschaubares Familiengefüge. Er dachte, dass Jacob, sein Vater, eher als Grossvater zu betrachten war und mit der Kinderfrau Monika auf einer Ebene stand, und dass Philipp derjenige war, der seiner Mutter Amalia am nächsten stand und ihr sowohl den kleinen Bruder Julius, der sechs Monate nach der Geburt starb[47], wie auch die kleine Schwester Anna in den Bauch gesetzt hatte, die wieder ein Jahr später zur Welt kam und bei Sig(is)mund ein Gefühl von Unmut, Unklarheit und Eifersucht weckte. “Das noch nicht dreijährige Kind hat verstanden, dass das letzthin angekommene Schwesterchen im Leib der Mutter gewachsen ist. Es ist gar nicht einverstanden mit diesem Zuwachs und (…) wendet sich (…) an den grossen Bruder, der (…) an Stelle des Vaters zum Rivalen des Kleinen geworden ist. Gegen diesen Bruder richtet sich (…) der (Verdacht), dass er irgendwie das kürzlich geborene Kind in den Mutterleib hineinpraktiziert hat.“ [48]
Wer nahm den Platz ein, den der Knabe einzunehmen wünschte, wer stand der Mutter am nächsten? Dass im Alltag trotz allen Vermutungen des Sohnes nicht Philipp, sondern Jacob mit der Mutter im gleichen Bett schlief, war nicht zu verstehen[49]. All dies gehörte zu den rätselhaften Unklarheiten rings um die Autorität des Vaters und um das Recht der Nähe zur Mutter, wie Freud sie als wichtigen Teil im „Familienroman der Neurotiker“ ausführte: „(…) das Kind begreift, dass ’pater semper incertus est’, während die Mutter ’certissima’ ist. So erfährt der Familienroman eine eigentümliche Einschränkung: er begnügt sich nämlich damit, den Vater zu erhöhen, die Abkunft von der Mutter aber als etwas Unabänderliches nicht weiter in Frage zu stellen.“[50]
Doch wie mächtig war Jacob, der Vater? Gewiss erschien er dem Kind nicht nur mächtig, sondern auch ohnmächtig, doch der Zweifel an der Macht des Vaters musste ständig verdrängt werden. Ein Beispiel war, dass Jacob nicht verhindern konnte, dass die Kinderfrau Monika von Philipp des Diebstahls angeklagt wurde, weil bei ihr „die blanken Kreuzer, Zehnerl und Spielsachen“ gefunden wurden, die, wie es hiess, dem zwei Jahre und acht Monate alten Sigmund entwendet worden seien, worauf sie für zehn Monate ins Gefängnis kam und dem Kind als Ersatzmutter (oder Ersatzgrossmutter) entrissen wurde. Ein weiteres Beispiel von Jacobs Ohnmacht war, dass er vor den Augen seines kleinen Sohns durch einen antisemitischen Mitbürger gedemütigt wurde (er musste ihm auf dem Gehsteig den Platz einräumen, der Hut wurde ihm vom Kopf in den Schmutz geschlagen und er musste sich bücken, um ihn wieder aufsetzen), schliesslich dass er, als 1857 die grosse Wirtschaftskrise einsetzte, sein Vermögen verlor und wenig später, 1859, mit seiner Familie zuerst nach Leipzig und kurz darauf nach Wien ziehen musste. Der Vater konnte nicht verhindern, dass Sig(is)mund fast gleichzeitig seine Kinderfrau und sein ländliches, vertrautes Umfeld entzogen wurde, dass er in die Eisenbahn gesetzt wurde und unterwegs nach Leipzig, in Breslau, eine schwere Feuersbrunst erlebte, dass er als Kind erlebte, was es bedeutet, in einer Grossstadt Fremder zu sein – und arm.
Die Armut setzte sich fort und belastete Freud sehr, sowohl in der Schul- und Studienzeit wie auch später, als er als junger Arzt zu wenig Einkommen hatte und Geld leihen musste (z.B. bei Josef Breuer), um seine eigene grosse Familie mit den eigenen sechs Kindern sowie die mittellosen, unverheirateten Schwestern und seine Eltern zu ernähren. Die bescheidene Begräbnisfeier für den verstorbenen Vater, den er ehren und keineswegs entehren wollte, hängt mit de Fortsetzung des Auszugs aus Freiberg zusammen.
Die vielen Träume, die nach dem Tod des Vaters einsetzten und für Freud erinnerbar blieben – so wie er sie Wilhelm Fliess erzählte und in die „Traumdeutung“ einbezog – , machen deutlich, wie komplex und widersprüchlich seine Beziehung zur Vaterfigur gewesen war und dass auch die frühkindliche Beziehung zur Mutter, die er immer wieder vermisste und deren Nähe er ersehnte, ein wichtiger Teil dieser Komplexität war. Das vielfältige Geheimnis um die Sexualität, um die triebhafte Lust und Zeugungsmacht des „coitus“ war durch die Familiengeschichte geweckt worden und wurde gleichzeitig tabuisiert, wodurch noch grössere Neugier und noch stärkere Wünsche angeregt wurden, Wünsche nach dem Besitz der unzugänglichen Mutter und geheime Todeswünsche dem Vater gegenüber.
Wie Ernest Jones festhielt, „weist alles darauf hin, dass Freuds bewusste Haltung gegenüber seinem Vater, obwohl dieser Autorität und Versagen verkörperte, durchwegs eine zärtliche, bewundernde und respektvolle war. Feindselige Regungen waren völlig auf Philipp und Emanuel verschoben. Es erschütterte Freud daher tief, als er vierzig Jahre später ‚die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater’ und damit ‚die packende Macht des Königs Ödipus bei sich entdeckte und sich eingestehen musste, dass sein Unbewusstes sich dem Vater gegenüber ganz anders eingestellt hatte als sein Bewusstes.“ [51] Freud selber hielt in seiner Betrachtung über die Bedeutung des Mythos fest, dass „ (König Ödipus’) Schicksal uns nur darum ergreift, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten; unsere Träume überzeugen uns davon. König Ödipus, der den Vater Laïos erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. (…) Wie Ödipus leben wir in Unwissenheit der die Moral beleidigenden Wünsche, welche die Natur uns aufgenötigt hat, und nach deren Enthüllung möchten wir wohl den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit.“[52]
Die Aufarbeitung seiner Vaterbeziehung als Sohn war Sigmund Freud dank der „Traumdeutung“, dank der Auseinandersetzung mit der „Psychopathologie des Alltags“ und mit „Totem und Tabu“ in weitem Mass gelungen. Die Konfrontation mit seiner eigenen Macht und Ohnmacht als Vater sowie als „Vater“gestalt für seine Schüler und Schülerinnen, Anhänger und Nachfolger wie auch deren Klärung erfolgte von Freud selber au fur et à mesure. Nur wenig davon konnten wir im Lauf dieser Vorlesung berühren.
Als Freud seine in mehreren Etappen vorgenommene Aufarbeitung des „Mannes Moses und der monotheistischen Religion“ 1934 für eine Publikation zu ordnen und niederzuschreiben begann, fühlte er sich in seinen Kräften eingeschränkt. Neben Erfreulichem – endlich eine grössere Anerkennung seiner Publikationen[53] und eine beachtliche Ausweitung der Psychoanalyse nach London und Paris[54], die Ehrung durch den Goethepreis im August 1930 und ein Jahr später durch seine Herkunftsstadt Freiberg-Pribor, die ihn noch stärker berührte[55], die zunehmend stellvertretende Präsenz durch seine Tochter Anna sowohl im Wiener „Comité“ wie an Kongressen -, hatte er viel Bedrückendes und Belastendes erlebt. Sein Gesundheitszustand ging seit den ersten Kieferkrebsoperationen von 1923 in Wien mit ständigen Schmerzen sowie wachsenden Einschränkungen und qualvollen Komplikationen einher, die immer wieder neue Operationen (in Berlin, schliesslich in London) nach sich zogen; zahlreiche ihm nächst- und nahestehende Menschen waren gestorben, Anfang September 1930 auch seine Mutter, deren Tod – anders als der Tod seines Vaters – „merkwürdig auf mich gewirkt hat, dies grosse Ereignis. Kein Schmerz, keine Trauer, was sich wahrscheinlich aus den Nebenumständen, dem hohen Alter, dem Mitleid mit ihrer Hilflosigkeit am Ende erklärt, dabei ein Gefühl der Befreiung, der Losgesprochenheit, das ich auch zu verstehen glaube. Ich durfte ja nicht sterben, solange sie am Leben war, und jetzt darf ich. Irgendwie werden sich in tieferen Schichten die Lebenswerte merklich geändert haben“[56], wie er Sandor Ferenczi, dem nächsten unter seinen Schülern, schrieb, der selber drei Jahre später, im Mai 1933, nach zunehmender angstbesetzter Umnachtung starb.
In der gleichen Zeit verfinsterte sich die politische Entwicklung in Deutschland und in Österreich, der Antisemitismus wurde nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933 von Tag zu Tag gewalttätiger, bedrückender und verhängnisvoller, da er nicht mehr gesetzeswidrig war, im Gegenteil; es kam zu immer weiteren Restriktionen, Publikationsverboten und schliesslich 1934 zu den Bücherverbrennungen, auch zur Verbrennung von Freuds Büchern in Berlin. Marthe Robert hält dazu fest: „Er nahm es zur Kenntnis und zitierte, ’er hörte auf die Welt zu verstehen!’ Seine Meinung war es, dass dieses barbarische Schauspiel nicht mehr sei als ein Symbol. Er ahnte nicht, dass dies der Auftakt zur tatsächlichen Austilgung (zur Verbrennung) seines Volkes war und dass zwölf Jahre später seine vier Schwestern, die er in Wien zurückgelassen hatte, auch unter den Millionen von Opfern sein würden.“[57]
Brauchte Freud die Grösse und Tragik der legendären Mosesgestalt, um sich selber in der sich für das jüdische Volk anbahnenden Tragik zu positionieren, als Sohn und als Vater, als Jude und als frei denkender Mensch, der den Mut hatte, eine neue Lehre aufzubauen, ja zu verkünden? „Angesichts der neuen Verfolgungen“ schrieb er am 30. September 1934 an Arnold Zweig „fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und warum er sich diesen unsterblichen Hass zugezogen hat“.[58] Es muss ein zugleich drängendes und ängstigendes Bedürfnis nach Klärung der Frage gewesen sein, das ihn bewog, der Quelle der Moses-Geschichte und der monotheistischen Religionen, insbesondere des Judentums nachzugehen, und es müssen widersprüchliche Energien in Freud gewirkt haben, die ihn bewogen, immer wieder Erarbeitetes zu überprüfen – insbesondere im dritten Teil – und neu zu formulieren, bis er sich zur Publikation entschliessen konnte.
So griff er in der dreiteiligen Abhandlung die Auseinandersetzung mit dem grossen Vater-Mythos auf wie mit der sich über Jahrhunderte fortsetzenden und ausweitenden Schuld der Söhne, die danach trachteten, sich über den Vater zu erheben. Betraf es nicht ihn selber, zugleich als Sohn seines Vaters Jacob (gemäss der biblischen Urvätergeschichten ist Jacob, wie in der 1. Vorlesung erwähnt, der Vater von zwölf Söhnen, die als die Stammesväter Israels gelten und zu denen Joseph, der zweitjüngste gehört, dessen Volk von Moses, dem ägyptischen Prinzen und charismatischen Verkünder des einen Gottes, aus Ägypten geführt wurde) wie als Vater sowohl seiner leiblichen sechs Kinder[59] wie der grossen Anzahl von „Söhnen“, die sich gegen ihn als ihren Stammesfürsten aufgelehnt hatten mit der Absicht, ihn zu verstossen? Auch wenn Freud nicht gläubig war, war er Teil dieses Volkes und dessen Geschichte, und obwohl er die Beziehung zu seinem eigenen Vater nach dessen Tod durch seine Selbstanalyse gut aufgearbeitet hatte, blieb in ihm immer noch ein Teil des Schuldgefühls haften, wie er noch im Januar 1936 festhielt, als er auf seine Empfindungen anlässlich der 1904 mit seinem Bruder Alexander realisierten Reise nach Athen und auf die Akropolis einging: „Es muss so sein, dass sich an die Befriedigung, es so weit gebracht zu haben, ein Schuldgefühl knüpft; es ist etwas dabei, was unrecht, was von alters her verboten ist. Das hat mir der kindlichen Kritik am Vater zu tun, mit der Geringschätzung, welche die frühkindliche Überschätzung seiner Person abgelöst hatte. Es sieht aus, als wäre es das Wesentliche am Erfolg, es weiter zu bringen als der Vater, und als wäre es noch immer unerlaubt, den Vater übertreffen zu wollen.“[60]
Was bei Sigmund Freud den inneren Zwiespalt bewirkte, mag ein Restbestand des alten Schuldgefühls gewesen sein, selbst in Sachen Religion mehr Wissen anzustreben als der Vater sich zumuten konnte, und zugleich trotz schwerstem körperlichen Leiden und existentieller Ungewissheit eine nicht nachlassende Erkenntnislust zu spüren, die wie ein loderndes, diagnostisches Feuer die Verzweiflung ob dem Judentum und das Restchen Liebe, das er dieser nicht gewählten Herkunft gegenüber empfand, zu erhellen trachtete. Schon am 4. Mai 1932 hatte er Arnold Zweig geschrieben: „Palästina hat nichts gebildet als Religionen, heiligen Wahnsinn, vermessene Versuch, die äussere Scheinwelt durch die innere Wunschwelt zu bewältigen, und wir stammen von dort (…), unsere Vorfahren haben dort vielleicht durch ein halbes Jahrtausend, vielleicht durch ein ganzes gelebt (aber auch dies nur vielleicht), und es ist nicht zu sagen, was wir vom Leben in diesem Land als Erbschaft in Blut und Nerven (wie man fehlerhaft sagt) mitgenommen haben. Oh, das Leben könnte sehr interessant sein, wenn man nur mehr davon wüsste und verstünde. Aber sicher ist man nur seiner augenblicklichen Empfindungen!“[61]
In der qualvollen Wartezeit bis die Gestapo nach Hausdurchsuchungen und Konfiskationen sowie langen, mühsamen Befragungen und Verhandlungen (bei denen Anna Freud den schwierigsten Teil auf sich nahm), nach wichtigen Interventionen aus dem Ausland, Bemühungen von Ernest Jones um Einreisevisa in England und Zahlungen von Kautionen, für welche Marie Bonaparte aus Paris ihre Hilfe anbot, endlich die Bewilligung für die Ausreise Freuds und seiner Familie aus Wien eintraf, in diesen letzten drei Monaten kam Freud zum Abschluss seiner grossen Untersuchung des väterlichen Erbes. Das grosse religiöse Tabu[62] um die von Moses dem einen Teil der Nachfolger Jacobs – dem Josefstamm – verkündete Vaterreligion, die sich bis ins Judentum unter dem Naziregime, ja bis in die heutige Zeit fortsetzte und in die hinein Sigmund Freud als Kind von Amalie Nathanson und Jacob Freud geboren worden war und die ihm anhaftete, Ungläubigkeit hin oder her, dieses Tabu wagte er anzutasten – und weit mehr, entgegen aller Verbote der Antastbarkeit und aller damit verflochtenen Ängste. Man muss sich vorstellen, wie viel Konzentration unter dem konstanten Schmerzzustand infolge des sich verschlimmernden Karzinoms[63] und gleichzeitig unter den existentiellen Schikanen und unabsehbaren politischen Bedingungen erfordert war, und zugleich wie viel Mut, um diese historische und analytische Zusammenfassung von schon Erarbeitetem und von neu Erkanntem zustande zu bringen – und zu publizieren; denn die Ergebnisse, zu denen Freud gelangte, waren kaum ein Trost für das jüdische Volk. Gleichzeitig waren sie ein hohes Wagnis hinsichtlich der zu erwartenden Reaktionen der katholischen Kurie. Doch für Freud selber entsprachen sie dem Befreienden, das mit dem Aufzeichnen von Erkenntnis einhergeht – ein Aussprechen war seit 1923, der ersten Operation, kaum mehr möglich. Freud wollte schriftlich festhalten, was ihm wichtig erschien – auch hier eine merkwürdige Analogie zu Mose, der ein „Stotterer“ war und deshalb der Zeichensprache, der Schrift, bedurfte. [64]
Kleine Ausschnitte können die Dringlichkeit, unter welcher Freud stand, belegen[65]:
„Es handelt sich um etwas Vergangenes, Verschollenes, Überwundenes im Völkerleben, das wir dem Verdrängten im Seelenleben des Einzelnen gleichzustellen wagen. In welcher psychologischen Form dies Vergangene während der Zeit seiner Verdunkelung vorhanden war, wissen wir zunächst nicht zu sagen. Es wird uns nicht leicht, die Begriffe der Einzelpsychologie auf die Psychologie der Massen zu übertragen, und ich glaube nicht, dass wir etwas erreichen, wenn wir den Begriff eines ‚kollektiven’ Unbewussten einführen. Der Inhalt des Unbewussten ist ja überhaupt kollektiv, allgemeiner Besitz der Menschen. Wir behelfen uns also vorläufig mit dem Gebrauch von Analogien. Die Vorgänge, die wir hier im Völkerleben studieren, sind den uns aus der Psychopathologie bekannten sehr ähnlich, aber doch nicht ganz die nämlichen. Wir entschliessen uns endlich zur Annahme, dass die psychischen Niederschläge jener Urzeiten Erbgut geworden waren, in jeder neuen Generation nur der Erweckung, nicht der Erwerbung bedürftig. (…)
Die Wiederkehr des Verdrängten vollzieht sich langsam, gewiss nicht spontan, sondern unter dem Einfluss all der Änderungen in den Lebensbedingungen, welche die Kulturgeschichte der Menschen erfüllen. (…) Der Vater wird wiederum das Oberhaupt der Familie, längst nicht so unbeschränkt wie es der Vater der Urhorde[66] gewesen war. Das Totemtier[67] weicht dem Gott in noch sehr deutlichen Übergängen. Zunächst trägt der menschengestaltige Gott noch den Kopf des Tieres, später verwandelt er sich mit Vorliebe in dies bestimmte Tier, dann wird dies Tier ihm heilig und sein Lieblingsbegleiter, oder er hat das Tier getötet und trägt selbst den Beinamen danach. Zwischen dem Totemtier und dem Gott taucht der Heros auf[68], häufig als Vorstufe der Vergottung. Die Idee einer höchsten Gottheit scheint sich frühzeitig einzustellen, zunächst nur schattenhaft, ohne Einmengung in die täglichen Interessen des Menschen. Mit dem Zusammenschluss der Stämme und Völker organisieren sich auch die Götter zu Familien, zu Hierarchien. Einer unter ihnen wird häufig zum Oberherrn über Götter und Menschen erhöht. Zögernd geschieht dann der weitere Schritt, nur einen Gott zu zollen, und endlich erfolgt die Entscheidung, einem einzigen Gott alle Macht einzuräumen und keine anderen Götter neben ihm zu dulden. Erst damit war die Herrlichkeit des Urhordenvater wiederhergestellt, und die ihm geltenden Affekte konnten wiederholt werden.
Die erste Wirkung des Zusammentreffens mit dem so lange Vermissten und Ersehnten war überwältigend und so, wie die Tradition der Gesetzgebung vom Berg Sinai sie beschreibt. Bewunderung, Ehrfurcht und Dankbarkeit dafür, dass man Gnade gefunden in seinen Augen – die Mosesreligion kennt keine anderen als diese positiven Gefühle gegenüber dem Vatergott. (…)“
Soweit erscheint Freuds Deutung von der rabbinischen[69] Theologie nicht weit entfernt zu sein. Auch hier handelt es sich um die von Moses an die „Grossen der Versammlung“, die „Väter“ überlieferte Lehre. „Die Schriftgelehrten haben die dazu notwendige Vollmacht oder Autorität, die sie von Moses herleiten: ’Mose empfing die (schriftliche und mündliche) Tora vom Sinaï her und überlieferte sie dem Josua, dieser den Ältesten, diese den Propheten, diese den Männern der Grossen Versammlung’, gemäss der ’Sprüche der Väter (1,1)’. Die ’Väter’ gehen weiter durch die gesamte Zeit des Zweiten Tempels und führen nahtlos in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach (Chr.)“.[70] Freud suchte jedoch keineswegs eine Annäherung an die rabbinische Deutung, im Gegenteil. Er wagte eine andere Deutung:
„Die Richtung dieser Vaterreligion war damit für alle Zeiten festgelegt, doch war ihre Entwicklung damit nicht abgeschlossen. Zum Wesen des Vaterverhältnisses gehört die Ambivalenz; es konnte nicht ausbleiben, dass sich im Lauf der Zeiten auch jene Feindseligkeit regen wollte, die einst die Söhne angetrieben, den bewunderten und gefürchteten Vater zu töten. Im Rahmen der Mosesreligion war für den direkten Ausdruck des mörderischen Vaterhasses kein Raum. Nur eine mächtige Reaktion auf ihn konnte zum Vorschein kommen, das Schuldbewusstsein wegen dieser Feindseligkeit, das schlechte Gewissen, man habe sich gegen Gott versündigt und höre nicht auf zu sündigen.“
Sigmund Freud erläuterte in der Folge, dass dieses Schuldgefühl, durch die Propheten ständig wach gehalten, zu einem „integrierenden Teil des religiösen Systems“ wurde. Da die auf Gott gesetzten Hoffnungen sich nicht erfüllten und es dem Volk schlecht ging, sei es nur möglich gewesen, „an der über alles geliebten Illusion festzuhalten, Gottes auserwähltes Volk zu sein“, indem die eigene Schuldhaftigkeit als Ursache für das Elend zu gelten hatte, und indem „die Gebote immer strenger, peinlicher und auch kleinlicher eingehalten werden mussten“. Freud hält fest, dass dadurch wohl „in Lehre und Vorschrift ethische Höhen“ erreicht worden seien, dass diese Ethik jedoch „ihren Ursprung aus dem Schuldbewusstsein wegen der unterdrückten Gottesfeindschaft“ nicht verleugnen könne. „Sie hat den unabgeschlossenen und unabschliessbaren Charakter zwangsneurotischer Reaktionsbildungen; man errät auch, dass sie den geheimen Absichten der Bestrafung dient.“
Was „geheim“ ist, gehört zum Nahen, ja zum Intimen. Es ist unantastbar, es untersteht dem Tabu. Was dem Tabu untersteht, geht mit einer Ansammlung von Verdrängtem einher, das jeder Zwangsneurose zugrunde liegt. Gemäss Freud, wie er hier ausführt, geht die Gläubigkeit in der Befolgung der strengen Gebote, Verbote und Rituale mit dem Beibehalten des Tabus einher. Die weitere Entwicklung – wie jede transgenerationelle Fortsetzung von Ängsten und von Unterwerfungshaltung – fasst Freud zusammen als eine Entwicklung, die über das Judentum hinaus ging und sich über alle Mittelmeervölker ausweitete – „als ein dumpfes Unbehagen, als eine Unheilsahnung“. Eine revolutionäre Stimmung breitete sich aus, ein Aufbruchbedürfnis setzte sich durch. „Die Klärung der bedrückten Situation“ geschah durch den Mut, den Jesus an den Tag legte, d.h. „sie ging vom Judentum aus“. Und es sei auch ein jüdischer Mann gewesen, Saulus aus Tarsus, der sich als römischer Bürger Paulus nannte, der erkannt habe, dass das so unglückliche Volk, das Gottvater getötet habe, sich „in der wahnhaften Einkleidung der frohen Botschaft: ‚Wir sind von aller Schuld erlöst, seitdem einer von uns sein Leben geopfert hat, um uns zu entsühnen’, die Versicherung hergestellt habe, dass das Opfer Gottes Sohn gewesen sei.
Beachtenswert erscheint Freud, wie sich die neue Religion mit der alten Ambivalenz im Vaterverhältnis auseinander gesetzt habe. „Ihr Hauptinhalt war zwar die Versöhnung mit Gottvater, die Sühne des an ihm begangenen Verbrechens; aber die andere Seite der Gefühlsbeziehung zeigte sich darin, dass der Sohn, der die Sühne auf sich genommen, selbst Gott wurde neben dem Vater und eigentlich an Stelle des Vaters. Aus einer Vaterreligion hervorgegangen, wurde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem Verhängnis, den Vater beseitigen zu müssen, ist es nicht entgangen.“
Dass nur ein Teil des jüdischen Volkes die neue Religion annahm und mit diesem Teil auch „Ägypter, Griechen, Syrer, Römer und endlich auch Germanen“ sowie viele weitere Völker, während ein anderer Teil sich weigerte, bedeute jene “Scheidung“, die, laut Freud, die zunehmende Absonderung derjenigen, die noch heute Juden heissen, bewirkt hat. Dass es ihnen unmöglich war, „den Fortschritt mitzumachen“, entspricht laut Freud einer „tragischen Schuld, die sie auf sich geladen haben und wofür sie schwer büssen müssen“. Warum dies geschehen sei, bedürfe einer besonderen Untersuchung.
Worin liegt in psychoanalytischer Hinsicht die Bedeutung von Freuds Untersuchung über den „Mann Moses und die monotheistische Religion“? Worin lag die Dringlichkeit, ja der innere Zwang, worunter er bei der beinah geheim gehaltenen Niederschrift stand, die kaum Angst vor der Publikation bewirkt hätte, wenn er sie nicht als wissenschaftliche Untersuchung, sondern als „Familienroman“ [71] hätte erscheinen lassen. In „Totem und Tabu“ hatte er festgehalten, dass „die Grundlage des Tabu ein verbotenes Tun ist, zu dem eine starke Neigung im Unbewussten besteht. (…) Der Mensch, der ein Tabu übertreten hat, wird selbst tabu, weil er die gefährliche Eignung hat, andere zu versuchen, dass sie seinem Beispiel folgen. Er erweckt Neid; warum sollte ihm gestattet sein, was anderen verboten ist?“[72] Tatsächlich hatte er, Teil des verfolgten Volkes und selber dem Tod nahe, mit seiner Moses-Untersuchung gewagt, ein religiöses Tabu zu übertreten.
Nun, sich selber als Neurotiker zu verstehen, hatte Sigmund Freud seit seiner – während der Freundschaft mit Wilhelm Fliess begonnenen – Selbstanalyse nicht abgewehrt. Er war damals 40 Jahre alt, als sein Vater 1896 als Einundachtzigjähriger starb und seine jüngste Tochter Anna knapp ein Jahr alt war. Mit Hilfe der Traumdeutung das Erkennen des Unbewussten und Verdrängten, damit des Tabuisierten und Verbotenen, das jedes menschliche Empfinden, Verhalten und Handeln beeinflusst, zu ermöglichen und im Zusammenhang der grossen Mythen wie jenes des Ödipus, der in Unkenntnis seiner Vatergeschichte zum Mörder des Vaters und zum Ehemann seiner Mutter wurde, als Teil der nicht lösbaren Vatergeschichte und damit einhergehender, verdrängter Todeswünsche zu benennen, wurde für Freud zum ersten grossen Werk, mit dessen Publikation (1900) er sein Abweichen von der Schulmedizin, seinen Mut zum Aussenseitertum – und seine neue Lehre der Psychoanalyse öffentlich bekundete. Dass er dafür während Jahren wie bestraft wurde und in Not leben musste, mag die Arbeit an „Totem und Tabu“ (1912-13) mitbegründet haben. Auch hier geht er auf die verborgenen Kräfte der Neurose, insbesondere der Zwangsneurose ein, die er mit dem Glauben an die „Allmacht der Gedanken“ [73] resp. mit dem Glauben an die die Kraft der Magie in den frühen, animistischen Weltauffassungen in Verbindung bringt. „Die primären Zwangshandlungen der Neurotiker sind eigentlich durchaus magischer Natur. Sie sind, wenn nicht Zauber, so doch Gegenzauber zur Abwehr der Unheilserwartungen, mit denen die Neurose zu beginnen pflegt. Sooft ich das Geheimnis zu durchdringen vermochte, zeigte es sich, dass diese Unheilserwartung den Tode zum Inhalt hatte. (…) Auch die Schutzformeln der Zwangsneurose finden ihr Gegenstück in den Zauberformeln der Magie.“[74]
Und 1938-39, als Freud sein Moseswerk schrieb und nach dem Auszug aus Wien zu veröffentlichen wagte, war für ihn auch hier „die Allmacht der Gedanken“ der drängende und tragende Impuls? Marthe Robert hat in ihrer sorgfältigen – und ebenfalls wagemutigen – psychoanalytischen Untersuchung Freuds klar diese Meinung vertreten.[75] Während „der Mann der beginnenden Reifezeit, der uns in der ’Traumdeutung’ begegnet, versucht im Traum den gesellschaftlich und intellektuell mediokren jüdischen Vater loszuwerden, der sein eigenes Leben an die unerträgliche Enge einer beschämenden Herkunft kettet, sieht für den Greis, der den ’Moses’ schreibt, die Situation ganz anders aus. Er zählt zu den berühmtesten Männern seiner Zeit und ist auf Rang und Titel nicht mehr angewiesen. Gerade weil er seinen Traum ernst zu nehmen verstand, hat er nach und nach seine kühnsten Ambitionen verwirklichen können. Aber bei der Erfüllung lässt ihn doch das Problem seiner Herkunft nicht los, das stets die eigentliche Antriebskraft seines Forschungsdrangs gewesen ist. Oder genauer gesagt: er kann nicht zur Ruhe kommen, ehe er nicht jene letzte Version gefunden hat, die endlich die Kette der Generationen aufbricht und ihn für immer frei macht von all den Vätern, Verwandten und Verfahren, die ihn die empörende Begrenzung der menschlichen Existenz spüren lassen. Kurz vor der Heimkehr zu seinen Väter oder, wie es in der Sprache der Bibel heisst, in Abrahams Schoss, erlebt Freud noch einmal einen letzten Sturm der Revolte gegen das unentrinnbare Schicksal der Sohnschaft, das jeden Menschen an Herkunft, Rasse und Namen bindet und so mit unübersteigbaren Schranken einengt. (…) Man kann sogar vermuten, dass er die Geschichte Moses und seines Volkes einzig und allein darum schreibt, weil er den furchtbaren Augenblick der Wiederkehr – ’Wiederkehr des Verdrängten’ und Heimkehr in den Schoss Abrahams – , den keine Macht der Welt ihm ersparen kann, noch ein klein wenig hinauszögern will.“
War es zutiefst und vor allem ein letztes, magisches Abwehrverhalten gegen die Unheilerwartungen, ein verzweifeltes und zugleich geniales Kräftemessen mit dem Tod, mit welchem Freud sich in die Nähe zu Moses versetzte? Marthe Robert stimmt dieser Deutung zu: „Um nicht sterben zu müssen, erklärt Freud in diesem Buch, das als sein Testament gelten darf, dass er nicht Salomon (Shlomo), der Sohn Jacobs ist und auch nicht Sigmund, der abtrünnig gewordene Sohn, dem schon sein Name ein grosses Geschick verheisst. Er ist so wenig Jude, wie Moses oder Moshe ein Jude war, auch wenn das jüdische Volk diesem fremdstämmigen Führer seine Existenz verdankt. Und so radikal wie Moses mit seiner ägyptischen Heimat und ihren Machthabern gebrochen hat, die ihn wegen seiner zukunftsweisenden Ideen verfolgten, hat auch Freud innerlich alle Bindungen an Deutschland gekappt, hat er nicht nur mit dem Deutschland der Nazis gebrochen, sondern mit allem, was noch deutsch an ihm war. Und so kann er nun in dem Augenblick, da er abtreten muss von der Bühne, auf der er so kühn seine Rolle gespielt hat, von sich sagen, dass er weder Jude noch Deutscher noch sonst irgend etwas ist, das mit Namen zu nennen wäre: er will nichts sein als der Sohn von Niemand und Nirgendwo, der Sohn einzig und allein seiner Werke und seines Werkes, dessen Identität wie die des ermordeten Propheten über die Jahrhunderte hinweg ein verwirrendes Rätsel bleibt.“[76]
[1] Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Bd. I: Die fünf Bücher der Weisung. 10. neu bearbeitete Auflage 1954 / Lambert Schneider Verlag, Heidelberg 1981
[2] ibdi. 1), S. 155
[3] In den letzten Monaten erlebte ich, wie aufwühlend es für viele Menschen, insbesondere für junge Menschen, war, den Film über den „da Vinci-Code” zu sehen, der das Tabu der Beziehung zwischen Jesus und Magdalena sowie eine mögliche, tatsächliche Vaterschaft Jesu thematisierte.
[4] Sigmund Freud. Der Mann Moses und die monotheistische Religion: Drei Abhandlungen (1939 / 1934-38), in Studienausgabe Bd. 9., S. Fischer-Verlag. Frankfurt a.M. 1974. – Yosef Hayim Yerushalmi. Le Moïse de Freud. nrf essais /Editions Gallimard, Paris 1993 (ursprünglich Freud’s Moses. Yale University Press 1991).
[5] Sigmund Freud. Totem und Tabu (1912-13), in: Studienausgabe, 9. Bd., S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1974
[6] u.a. Wilhelm Fliess (der Freud während fünf Jahren nächststehende, zwei Jahre jüngere Wahlbruder, den er bewunderte, verehrte und liebte und dessen zunehmende Entfremdung ihn zutiefst verletzte), C.G. Jung (von Ludwig Binswanger an Freud überwiesen, den dieser als nichtjüdischen Hoffnungsträger verherrlichte, der ihn jedoch nach anfänglicher Gefolgschaft durch den eigenen Machthunger zu entthronen suchte), Otto Gross und V. Tausk sowie Otto Rank (zerbrachen früher oder später ob den Folgen des Ersten Weltkriegs), Sandor Ferenzci (jener “Schüler“, den Freud nach dem Verlust der Freundschaft mit Wilhelm Fliess als den ihm nächststehenden betrachtete und wie einen Sohn liebte), W. Stekel sowie A. Adler, die sich mit eigenen Theorien etwa gleichzeitig wie Jung von Freud abspalteten u.v.m.
[7] Die religiöse Verehrung der Sonne resp. des Lichts kann als Ahnung der erst in jüngster Zeit erfolgten wissenschaftlichen Erkenntnisse des vor 4,5 Milliarden Jahren (nach dem mehr als doppelt so weit zurückliegenden Urknall, durch den die gewaltige Ausdehnung des Universums zustande kam) sich bildenden Sonnensystems betrachtet werden, bei dem der Planet Erde abgespalten wurde mit allem, was die allmähliche, vor rund 3,5 Milliarden Jahren durch die ernährende und regulierende Kraft des Sonnenlichts und des dadurch ausgelösten Sauerstoffgases sich entwickelnde Fülle von pflanzlichem und allmählich animalischen und menschlichem Leben bedeutet, ein sich physikalisch und biochemisch zwar erklärbarer Ablauf, der jedoch alle Zeit- und Raumkonstrukte menschlichen Verstehungsvermögens, das selber von der Lichtenergie abhängig bleibt, sprengt. – cf. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (geb. 12.08.1887 in Wien, gest. 04.01.1961 auch in Wien). What is Life? Dublin 1944 / Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. Leo Lehner Verlag (Sammlung Dalp), München 1951 / Geist und Materie. Diogenes Verlag, Zürich 1994. – Zu empfehlen die Publikationen und u.a. in der NZZ erschienenen Artikel von Gottfried Schatz (geb. 18.08.1936 in der Nähe von Graz; Prof. emeritus für Biochemie an der Uni Basel und Leiter des Zentrums für Biochemie), der sich u.a. auf Erwin Schrödinger beruft.
[8] cf. Jan Assmann. Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. Verlag C.H.Beck, München 1990. – Ägyptisches Totenbuch. Übersetzt und kommentiert von Grégoire Kolpaktchy. O.W. Barth Verlag, München 1990. –
[9] Variationen und Differenzen gab es schon seit frühester Zeit in den ersten Aufzeichnungen der über Generationen erzählten Mythen. Für Homer z.B. bestand die von Zeus, dem jüngsten Sohn des Urvaters Chronos, der diesen besiegt und in den Tartaros gezwungen hatte, nicht abhängige, sondern unabhängige Kraft der Moira – des Schicksals –, doch bei Hesiod waren auch die drei Moiren[9] Töchter des Zeus und der Themis, einer der Töchter des Uranos und der Gaia. Zeus wurde so zum unumschränkten Herr, Gebieter und Richter, der als Schutzherr Gebete erhöhte und staatliche Ordnung schützte, doch jede Auflehnung mit Gewalt bestrafte, auch jene seiner göttlichen und halbgöttlichen Söhne und Töchter, die aus den vielfachen Ehen mit göttlichen und menschlichen Gemahlinnen geboren worden waren und selber über vielfache Macht
[10] Sigmund Freud. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. cf. 4), III, I (D)
[11] ibid. 8), S. 537
[12] Salvatore Quasimodo (geb. 1901, gest. 1968), Sohn eines Eisenbahners, lernte im Selbststudium Latin und Griechisch, war ein hervorragender Übersetzer grosser Werke aus den alten Sprachen wie aus dem Englischen und Französischen, war 1959 Nobelpreisträger für Literatur. – Das Gedicht “An den Vater” erschien 1958 in “La terra imperaggiabile”; es findet sich in der Sammlung ausgewählter Gedichte von Salvatore Quasimodo (auf Italienisch und ins Deutsche übersetzt von Gianni Selvani) in “Das Leben ist kein Traum”. Piper Verlag, München/Zürich 1987, S. 52-55
[13] René Beer-Hofmann ( geb 11.07.1866 in Rodau/Wien, gest. 26.09.1945 in New York). Schlaflied für Mirjam. In: Jahrhundertgedächtnis. Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Harald Hartung. Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1998, S. 32
[14] Arnold Zweig. Ein kleiner Held, in: Knaben und Männer. S. 63, Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 1931.
[15] geb. 10. 11. 1887 in Polen, gest. 26. 11. 1968 in Ostberlin
[16] Der Untertitel verweist auf den Inhalt: Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargestellt am Antisemitismus. Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam 1927
[17] Arnold Zweig hatte die Kindheit im niederschlesischen Glogau (heute polnisch Glogov) als Sohn einer zugleich emanzipierten und traditionell-jüdischen Handwerkerfamilie erlebt. Sein Vater Arnold Zweig war Sattlermeister, der dem Sohn Gymnasium und Studium in Breslau (polnisch Wroclaw), München, Berlin, Göttingen, Rostock und Tübingen ermöglichte. Früh schon, beinah mit den ersten literarischen Publikationen, kam Arnold Zweig 1915 – er war 28 Jahre alt – öffentliche Beachtung, ja Ehrung[17] zu. Gleichzeitig wurde er als Soldat der Preussischen Armee in den Ersten Weltkrieg eingezogen und machte in den zermürbenden Schlachten in Serbien, in Belgien und im französischen Verdun alle Erfahrungen der Sinnlosigkeit des Kriegs und der Hilflosigkeit des einzelnen Menschen. Er wurde zum überzeugten Pazifisten, war jedoch weiter als Armeeberichterstatter der Kriegsgeschehnisse in Osteuropa eingesetzt. Damit hatte er nächste Kenntnis der desolaten Verluste der Preussischen Armee und der damit einhergehenden Armut der Bevölkerung , lernte jedoch die Bedeutung der zionistischn Bewegung für das von Pogromen heimgesuchte Ostjudentum kennen. Martin Bubers sozialistischer Zionismus überzeugte zunehmend auch ihn. Noch mitten im Krieg heiratete er seine Cousine Beatrice Zweig – Dita -, eine Malerin, die ihm zwei Söhne gebar, Michael (1920) und Adam (1924). Während der Weimarer Republik befasste sich Arnold Zweig in gesellschaftskritischen Romanen mit den Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs, auch mit der Betörbarkeit sowohl der armen Leute wie der bürgerlichen Intellektuellen durch politische Theorien und Utopien. Er stand damit Lion Feuchtwanger nah, der ihn Zeit seines Lebens unterstützte. Nach dem Hitlerputsch von 1923 sah Arnold Zweig sich in München gefährdet, zog mit seiner Familie nach Berlin, publizierte weiter und trat dem P.E.N.-Club bei. Doch als 1933 auch seine Bücher in Deutschland verbrannt wurden, zog er zusammen mit seiner Frau und den zwei Söhnen über die Tschechoslowakei und die Schweiz nach Sanary-sur-Mer in Südfrankreich, wo er Lion Feuchtwanger, Annah Seghers und Bertold Brecht wieder traf, sich jedoch entschloss, nach Haifa ins damalige Palästina zu ziehen. Doch es war ein politisch und kulturell zutiefst belastendes Exil, das ihn bewog, 1948 nach Ost-Berlin zurückzukehren. Er wurde Mitglied des Weltfriedensrates und Abgeordneter der Volkskammer der DDR, wurde vielfach geehrt, erblindete zunehmend und starb mit 81 Jahren, am 26. November 1968. Sein Grab befindet sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.
[18] Sigmund Freud-Arnold Zweig. Briefwechsel. Hrsg. Ernst L. Freud. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1984, S. 157
[19] Hugo von Hofmannsthal, geb. 01.02.1874, brach am 15. Juli 1929 tödlich zusammen, als er sich auf den Weg zum Begräbnis seines ältesten Sohnes machen wollte, der sich zwei Tage vorher selber das Leben genommen hatte.
[20] Arthur Schnitzler, geb. 1862 in Wien, Sohn des Kehlkopfspezialisten Johann Schnitzler, dessen Assistent er wurde, war ab 1885 mit S. Freud sowie ab 1890 mit Hugo von Hofmannstahl in nahem Kontakt.
[21] cf. 18), S. 42
[22] cf. 18), S. 18-21
[23] cf. 18), S. 25-26. Stefan Zweig (geb. 28.11.1881 in Wien, gest. 23 02.1942 durch Selbstmord in Petropolis bei Rio de Janeiro) hatte in einem literarischen Essay Freuds psychoanalytische Entdeckung und Auseinandersetzung mit dem Unbewussten mit Franz Anton Mesmer (1734-1815) und dessen Magnetismus sowie mit der Amerikanerin Mary Eddy Baker (1821-1910), der Gründerin der Christian Science und der damit verbundenen Praxis des “christlichen Heilens”, in Verbindung gebracht. – Stefan Zweig. Die Heilung durch den Geist. Insel Verlag, Leipzig 1931. (Dieses Buch wurde von Stefan Zweig Albert Einstein gewidmet, den er 1928 im Versammlungsraum der Christian Science in Princeton besucht hatte).
[24] Brief vom 4. Mai 1932, cf. 17), S. 50
[25] cf. 17), S. 55
[26]Sigmund Freuds Vater Jacob Freud war mit einundachtzigeinhalb Jahren gestorben.
[27] cf. 18), S. 149
[28] cf. 18), S. 166
[29] cf. 18), S. 178
[30] cf. 17), S. 179
[31] cf. 17), S. 186
[32] cf. 17), S. 188
[33] cf. 17), S. 191
[34] Caliban (Anagramm von canibal), eine fiktive Halbtier-Halbmenschgestalt, tritt in Shakespear’s “Sturm” erst gegen Ende auf, ein bewegende Figur der Konfrontation von wilder Naturhaftigkeit und Unterwerfung unter führungsmächtige Herrscherfiguren. Es gibt im 3. Akt, 2. Szene eine bedeutungsvolle Rede Calibans, die deutlich macht, wie sehr diese Gestalt im Vorfeld des Rationalen lebt (gemäss der Übersetzung von A.W. von Schlegel): “Sei nicht furchtsam, die Insel ist voll von Geräuschen, tönen und anmutigen Melodien, was Freude bringt und nicht schmerzt. Manchmal erklingen tausend klimpernde Instrumente über meinem Haupte – und manchmal hör’ ich Stimmen, die, wenn ich nach langem Schlaf erwachen würde, mich wieder schläfrig machten; dann deucht’s mir im Traume, die Wolken täten sich auf und offenbarten Schätze, bereit, auf mich herab zu regnen, dass ich, wenn ich erwache, schrei’ und weine, weil ich wieder träumen möchte.” (Erste Aufführung von “Tempest” am 1.11.1611 im Schloss Whitehall vor dem König, dann am 20.5. 1613 anlässlich der Hochzeit von Prinzessin Elisabeth, der ältesten Tochter von König Jacob, mit dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz)
[35] Arnold Zweig oder Politik und Leidenschaft. cf. 15), S. 11-12
[36] mit Martha Bernays (1861-1951), Tochter einer angesehenen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie aus Hamburg
[37] Mathilde (1887-1978), Jean Martin (1889-1967). Oliver (1891-1969), Ernst August (1992-1970), Sophie (1893-1920), Anna (1895-1982)
[38] Wilhelm Fliess (geb.1858 in Ahrenswalde, heute Choszczvo, gest. 1928), aus sephardischer Familie, hatte nach Abschluss des Medizinstudiums in Berlin drei Monate im Wiener Allgemeinen Krankenhaus gearbeitet und anlässlich einer Abendgesellschaft bei Josef Breuer Sigmund Freud persönlich kennen gelernt. Er spezialisierte sich auf den Nasen-Halsbereich und brachte diesen in Verbindung mit einer weiblichen und einer männlichen Perioden- und Reflexzonentheorie, vertrat dabei auch die Theorie der Bisexualität und unterstützte Freud bei der Entwicklung der Neurosentheorie. Nach ca. fünf Jahren intensivster Freundschaft entstand eine wachsende Differenz zwischen den beiden, die Freud zutiefst verunsicherte.
[39] Der Briefwechsel Sigmund Freud-Wilhelm Fliess findet sich einerseits in der Gesamtausgabe im Fischer Verlag, Frankfurt a.M., andererseits bei Didier Anzieu. Freud’s Selbstanalyse. Bd. I 1895-1898; Bd. II 1898-1902. Verlag Internationale Psychoanalyse, München-Wien 1990, auf die ich mich hier beziehe. Betr. alles Zitate von Freuds Briefen rund um den Tod seines Vaters cf. Bd.I, S. 75-76 ff.
[40] Sigmund Freud. Die Traumdeutung. S. Fischer-Verlag, Frankfurt a. M. 1972 (Erste Publikation 1899 resp. 1900 im Verlag Franz Deuticke, Leipzig/Wien), S. 315 ff
[41] Freud bezieht sich hier auf seine Forschungsarbeit im Laboratorium von Ernst Brücke (18876 bis 1882), die er mit seinem Doktorat abschloss, ferner auf seine daran anschliessende Arbeit im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, bei welcher die bis 1894 dauernde, dann abgebrochene Freundschaft mit dem 12 Jahre älteren Arzt Josef Breuer und die gemeinsame Erforschung der Zusammenhänge von Hysterie einsetzte (der Fall Anna O. resp. Bertha Pappenheim, mit ihr die Erkenntnis der begrenzten Heilungsmöglichkeit durch Hypnose wie auch jene der Wichtigkeit der„talking cure“) wie von Cerebrallähmungen bei Kindern (verbunden mit gemeinsamen Publikationen), ferner die mit dem Entwurf einer Neuronentheorie verbundene Anstellung als Assistenzarzt in der Abteilung für Psychiatrie (später Abteilung für Nervenkrankheit) von Theodor Meynert, ferner die viereinhalbmonatige Zusammenarbeit (Mitte Oktober 1885 bis Ende Februar 1886) mit dem in seiner diagnostischen und therapeutischen Arbeit bedeutenden Neurologen Jean-Martin Charcot in der Salpêtrière in Paris, dann mit der Praxiseröffnung im April 1886 die persönlichen Untersuchungs- und Behandlungserfahrungen (in nahem Austausch mit Wilhelm Fliess bis 1900, die mit einer leidenschaftlichen Freundschaft einherging, die einer Hörigkeit gleich kam, bis sich Freud bewusst wurde, dass die von ihm mittels Fliess angestrebte „Selbstanalyse“ von diesem nicht mitgetragen wurde ), sowohl der kathartischen Methode wie der Methode der „freien Assoziation“, für welche ab März 1896 die Bezeichnung Psychoanalyse verwendet wurde.
[42] cf. 38), S. 24
[43] cf. 41), S. 315f; cf. auch Briefwechsel Freud-Fliess, Brief vom 2. November 1896, cf. auch 40) Didier Anzieu, Bd. I, S. 76 ff
[44] der letztgeborene Alexander stand dem zehn Jahre älteren erstgeborenen Sjg(is)mund am nächsten; die übrigen Geschwister waren Julius, der mit sechs Monaten starb, Anna, Rosa, Marie, Adolfine und Pauli.
[45] Jacob Freuds zweite Ehefrau Rebecca blieb kinderlos
[46] Sigmund Freud. Briefe 1873-1939 (ausgewählt von Ernst und Lucie Freud), S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1968 / 1980, S. 411 f (Brief an A.A. Roback, 20. 02. 1930)
[47] Für Freuds Mutter eine doppelte Tragik, da während der Schwangerschaft von Julius schon ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Julius, der ihr am nächsten gestanden hatte, wegen Tuberkulose verloren hatte.
[48] Sigmund Freud. Psychopathologie des Alltagslebens (1904), Gesammelte Werke, Bd. IV. S. fischer Verlag, Frankfurt a. M.1970, S. 24
[49] cf. a) Ernest Jones. Sigmund Freud. Life and work. Bd. I: The young Freud 1856-1900. Hogarth Press, London. S. 28f . (In deutscher Übersetzung: Das Leben und Werk Sigmund Freuds. 3 Bände / Bd. I Die Entwicklung zur Persönlichkeit und die grossen Entdeckungen 1856-1900 (Bd. II. Jahre der Reife 1901-1919; Bd. III. Die letzte Phase 1919-1939) – b) Marthe Robert. Die Revolution der Psychoanalyse. Leben und Werk von Sigmund Freud. Übersetzt aus dem Französischen von Elisabeth Wiemers und Elisabeth Mahler. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1967, S. 26f (Erstausgabe: La Révolution psychoanalytique. La vie et l’oeuvre de Sigmund Freud. Editions Payot, 1964)
[50] Sigmund Freud. Der Familienroman der Neurotiker (1908). Studienausgabe Psychologische Schriften. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1970, S. 221-226. (Erstmals erschienen in Otto Rank. Der Mythus von der Geburt des Helden. Verlag Deuticke, Leipzig & Wien 1909; 2.Aufl. 1922, S. 82-86)
[51] Ernest Jones cf. 45)
[52] cf. 41), S. 267
[53] 1924 erfolgte die erste Ausgabe von Freuds Gesammelten Werken
[54] Im September 1926, im Anschluss an Freuds 70. Geburtstag, erfolgte die Gründung der Londoner Klinik sowie die Gründung der „Psychoanalytischen Vereinigung von Paris“ sowie des „Französischen Instituts für Psychoanalyse“.
[55] An den Bürgermeister von Freiberg-Pribor schrieb Freud am 25. 10. 1931: „Ich habe Freiberg im Alter von drei Jahren verlasen, es mit 16 Jahren als Gymnasiast auf Ferien, Gast der Familie Fluss, wieder besucht und seither nicht wieder. Vieles ist seit jener Zeit über mich ergangen (…). Es wird dem nun Fünfundsiebzigjährigen nicht leicht, sich in jene Frühzeit zu versetzen, aus deren reichem Inhalt nur wenige Reste in seine Erinnerung hineinragen, aber des einen darf ich sicher sein: tief in mir, überlagert, lebt noch immer fort das glückliche Freiberger Kind, der erstgeborene Sohn einer jugendlichen Mutter, der aus dieser Luft, aus diesem Boden die ersten unauslöschlichen Eindrücke empfangen hat.“ In: Briefe, cf. 47), S. 425
[56] cf. 47), S. 418
[57] Marthe Robert cf. 50b), S. 342
[58] cf. 18), S. 102
[59] von denen Sophie Halberstadt-Freud, die von ihrem Vater besonders geliebte Zweitjüngste, bei der Geburt des zweiten Sohnes starb.
[60] cf. 47) Brief an Romain Rollan (Beitrag zur Festschrift zu dessen 70. Geburtstag)
[61] Cf. 18), 53
[62] aus einer polynesischen Sprache (vermutlich Tonga) abgeleitet, bedeutet unantastbar, aber auch unverletzlich.
[63] Eine ausführliche analytische und medizinisch-anamnestische Abhandlung über Freuds Gaumen- und Kieferkrebs findet sich bei Jürg Kollbrunner. Der kranke Freud. Verlag Kett-Cotta,, Stuttgart 2001
[64] Eine kaum beachtete Erweiterung von Freuds Untersuchung und Deutung der Moses-Gestalt findet sich im kleinen Werk von Otto Kraus. Moses, der Erfinder der Buchstaben, der Ziffern und der Null. Selbstverlag Otto Kraus, Bederstrasse 123, 8002 Zürich, 1953. Otto Kraus vergleicht Freuds Thesen mit den auch von Freud beigezogenen früheren Moses-Untersuchungen von Eduard Meyer sowie mit jenen von Rudolf Kittel; dabei betont er, dass „Freud das Problem in seinem Umfang am genauesten erfasste“ (S. 12). Für Otto Kraus ist eines der massgeblichen Kriterien, die zu beachten sind, dass Moses ein Stotterer war, wie er durch verschiedene Stellen der „Schrift“ belegt. Die grosse Einsicht in die Ordnungskraft des Göttlichen habe sich durch Moses daher nicht – oder nur ungenügend – aussprechen lassen. Er habe anderer Zeichen bedurft, der Zeichen der Konsonanten, die ihm – gemäss der Geschichte vom brennenden Dornbusch, den das Feuer nicht verzehrte – durch die Figur der Flammen offenbart worden seien und die ihm ermöglicht hätten, die zehn Gebot, die er im Auftrag des unsichtbaren, transzendenten und alleinigen Gottes den Menschen für ihr Verhalten zu diesem Gott und unter einander zu vermitteln hatte, auf den „Tafeln“ schriftlich aufzuzeichnen.
[65] Sigmund Freud. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. III.Teil. Gesammelte Werke, Bd. 9. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 576ff
[66] dessen Bedeutung wurde von Freud ausführlich abgehandelt in: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker (1912-1913). In: Gesammelte Schriften. Bd. 9, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 287-444
[67] Die etymologische Erklärung von Totem: „Totem“ ist abgeleitet aus „ototeman“ und hat gemäss der Sprache des amerikanischen Indianervolkes Algonkin die Bedeutung „sein geschwisterlicher Verwandter“ oder „sein Bruder“ bzw. „seine Schwester“; „ote“ bezeichnet die Verwandtschaft zwischen leiblichen (sowie Adoptiv)geschwistern und wird mit einem vorangesetzten Personalpronomen ( „o“ – „sein“) und einem possessiven Nominalsuffix (-„m“ – „eigen“) und ev. Mit einem Suffix der 3. Person (-„a“ oder „an“) verbunden; das erste „t“ ist eingeschoben, um den Zusammenstoss der beiden „o“ zu vermeiden. Wörtlich bedeutet „o-t-ote-m-a(n)“ also „sein eigener Bruder-Schwester-Verwandter“. – Der Begriff „ote“ bezeichnet aber nicht der den Verwandten innerhalb der Familie, sondern auch ein Tier, das aus irgend einem Grund zum Symbol einer Familie gemacht wurde, dadurch als verwandt gilt und von einer Generation auf die andere „vererbt“ wird. (cf. Etymologisches Wörterbuch. Lexikographisches Institut, München 1982)
[68] Häufig wird Moses in der bildenden Kunst gehörnt dargestellt, cf. Abbildungen 10, 11 und 12 in: Gerda Weiler. Das Matriarchat im Alten Israel. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart/Berlin/Köln 1989, S. 154 ff. – Auch die ägyptischen Gottheiten wurden vor und nach Echnaton und dessen einem Gott, dem Sonnengott Aton, mit Tierhäuptern dargestellt, wie auch in der griechischen Mythologie die Verbindung von Göttergestalten mit Tier und Mensch von zentraler Bedeutung war. – Noch in der frühchristlichen Bilderdarstellung findet sich z.B. je ein Tier in Verbindung mit den vier Aposteln.
[69] „Rabbi“ hat die Bedeutung von „Meister“ in der Deutung der „Schrift“, d.h. von Schriftgelehrtem.
[70] Pnin Navè Levinson. Einführung in die rabbinische Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, S. 1-2
[71] Auf die Bedeutung war Freud schon 1908 eingegangen; cf. 51)
[72] Totem und Tabu (1912-1913). Studienausgabe Bd. 9, S. 324
[73] cf. 69). S. 374
[74] cf. 69), S. 375-376
[75] Marte Robert. Sigmund Freud – zwischen Moses und Ödipus. Die jüdischen Wurzeln der Psychoanalyse. Paul List Verlag KG, München 1975. Aus dem Französischen übersetzt von Hans Krieger. Die Originalausgabe ist: D’Oedipe à Moïse – Freud et la conscience juive. Edition Calmann-Lévy, Paris 1974
[76] cf. 73), S. 158
Väterliche Erbschaften
Salongespräche UniS Bern – Wintersemester 2007-2008
- Vorlesung
Vaterschaften und Wahlvaterschaften – Sohnesgeschichten:
Sigmund Freud
In allen Mythologien ist die grosse Geschichte schöpferischer und zerstörerischer Geschehnisse Folge zugleich göttlichen und animalischen Handelns, das sich im Menschsein sowohl verkörpert wie vergeistigt – und fortsetzt. Dass in Zusammenhang der monotheistischen Religionen die zwei sich ergänzenden Geschlechter – das männliche und das weibliche – in ungleiche Machtverhältnisse gerieten, durch welche die väterliche Herkunft während Jahrhunderten als jene der Zeugung zu jener der Namengebung wurde und von überwiegender Bedeutung bezüglich Herrschaft, Besitz und/oder Zugehörigkeit war, das wirkte sich in den privaten, innerfamiliären Verhältnissen ebenso aus wie in den öffentlichen Strukturen – bis in die heutige Zeit, jeglicher Aufklärung und Emanzipation zum Trotz. Der Machtkampf zwischen Vater und Sohn wie zwischen den Brüdern um den Platz der Herrschaft hat sich in unendlichen Variationen wiederholt, wie schon erwähnt auch unter den Nachfolgern Freuds. Ohne Zweifel geht die Frage der Deutung des archaisch-testamentarischen Imperativs „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“ -, wie J. W. Goethe ihn in Faust I formuliert hat, mit jener der persönlichen Wahlmöglichkeiten einher, die im Verhältnis zur nicht wählbaren Herkunftsgeschichte – Familiengeschichte, Stammbaum, Abkunft und Name – dem Menschen zustehen.
Doch was heisst in Zusammenhang väterlicher Herkunft „erben, erwerben und besitzen“? Geht es um die Art der Fortsetzung des väterlichen Namens oder der familiären Geschichte? – oder geht es um die Übernahme und Verstärkung dessen, was die Macht des Vaters ausmachte: Nähe zur Mutter, Herrschaft über untergeordnete Menschen, z.B. über „schwächere“ oder jüngere Brüder, über Schwestern, über Angestellte, Lehrlinge, Schüler und Schülerinnen, letztlich über ein Volk? – geht es um materiellen Besitz, um Boden und Vieh resp. Geld und Aktien? Geht es letztlich um Übernahme und Erneuerung väterlicher Potenz in der ganzen Bedeutung? Die Art der Vatererfahrung und des daraus wachsenden Vaterbildes entspricht einer Vielzahl von Abhängigkeitstatsachen, von deren missbräuchlichen Ausnutzung über verantwortungsbewusste Sorgfalt bis zur Ausweitung individueller Macht oder Ohnmacht in kollektive Unterwerfungsforderung oder Anpassung.
Allein in den Wochen der Vorbereitung dieses Semesters fanden sich in Literatur und Tagespresse sowie in den therapeutischen Sitzungen und in anderen Gesprächen Vaterbenennungen in allen Variationen vor, die ich zu notieren begann: „verehrter, liebster Vater Freud“ (Arnold Zweig, Anrede im Briefwechsel), „liebster Vater „ (Franz Kafka, Anrede im Brief an den Vater), väterliche Macht/väterliche Gewalt/väterlicher Drill (Gespräche), oh mein Papa (Gespräch mit junger Frau, in trällernder Nachahmung von Lys Assia), Vater-Vati-Papi-Daddy–Grossvater/Grossväter/Urgrossväter (Gespräche), „am Gängelband des Patriarchen“ (betr. Goethes Sohn August, NZZ 9./10. 6. 07), „Ersatzvater“ (betr. Religion, NZZ, 12.6.07), allmächtiger Vater/unser Vater/Vater unser/Pater noster/Pater Franz/Heiliger Vater (religiöse Assoziationen in Gesprächen), „unmässige Vaterliebe“ (betr. King Lear, NZZ, 1.6.07, S. 45), „Vaterkönig, schuldlos-schuldig, der die tragische Fallhöhe garantiert“ (betr. Lucia Joyce / James Joyce, NZZ, 7./8. 7. 07), „Gründungsvater der abendländischen Philosophie“ (betr. Platon / Richard Rorty, NZZ, 12. Juni 07), „Vater von Konzeptkunst“ (betr. Sol le Witt, NZZ, 10. 4. 07), „Vater der modernen Kunstkritik“ (betr. Pietro Aretino, NZZ, 14./15. 4. 07), Landesvater/Vater aller Völker (betr. Stalin und Putin, NZZ, 14. 6. 07) etc. etc.
Bei allen Benennungen geht es um Beziehungsaspekte von persönlicher und intimer oder kollektiver, allgemeiner Bedeutung, es geht um einen persönlichen Vater, um den fehlenden Vater, den angsteinflössenden und strafenden Vater, um den Vater als Beschützer und Erzieher, um den Vater als mächtigen Richter, um Väter und Söhne, Väter und Töchter, biblische Urväter, griechische Götterväter, Väter als Inzesttäter, Väter als Sohnesmörder, Väter als Lehrmeister, Väter als Firmenchefs, Väter als Staatschefs, Väter in Zeitungsartikeln, Väter in Treppenhausgesprächen, etc. etc.
Selten kommt es vor, dass der einfache, machtlose und doch starke Vater, wie er in Salvatore Quasimodo’s Erinnerungsgedicht erscheint, lange nach dessen Tod in einem zu Lebenszeiten nicht benennbaren Wert geehrt wird:
„(…) Deine traurige, zarte
Geduld nahm uns die Angst
War Lehre von Tagen, zu denen gehörte
der betrogene Tod, die Verhöhnung der Diebe,
gefangen in den Trümmern und im Dunkel gerichtet
vom Gewehrfeuer der Gelandeten, eine Rechnung
niedriger Zahlen, die genau konzentrisch
aufging, eine Bilanz zukünftigen Lebens.
Deine Sonnenmütze ging auf und ab
in dem geringen Raum, den sie dir immer gaben.
Auch mir massen sie alles zu,
und ich habe deinen Namen ein wenig weiter
getragen, über Hass und Neid hinaus.
(…)
Und jetzt im Adler deiner neunzig Jahre
wollt ich sprechen mit dir, mit deinen bunten
Abfahrtssignalen aus der Nachtlaterne,
und hier, aus einem mangelhaften
Rad der Welt, auf einer Menge dicht gedrängter Mauern,
weit fort vom arabischen Jasmin,
bei dem du noch bist, um dir zu sagen,
was ich früher nicht sagen konnte
– schwierige Gedankenverwandtschaft –
um dir zu sagen, und es hören uns nicht nur
die Zikaden am Scheideweg, die Mastixagaven,
wie der Feldhüter sagt zu seinem Herrn:
‚Wir küssen die Hände.’ Dies, nichts anderes.
Geheimnisvoll stark ist das Leben.“[1]
Noch seltener lässt sich persönliche Bescheidenheit eines Vaters vernehmen, indem er dem Kind zu verstehen gibt, es möge besser sich von seinem Erbe abwenden und das eigene Leben leben. Nicht an einen Sohn, sondern an eine Tochter richtet sich der Rat „Horch nicht auf mich“, auch die Erklärung, dass „keiner keinem ein Erbe sein kann“. Stehen Töchtern grössere Wahlmöglichkeiten als Söhnen zu?
„Schlaf, mein Kind – schlaf, es ist spät! Schlaf mein Kind – der Abendwind
weht.
Sieh wie die Sonne zur Ruhe dort geht. Weiss man, woher er kommt, wohin er
geht?
Hinter den Bergen stirbt sie im Rot. Dunkel, verborgen die Wege hier sind,
Du – du weißt nichts von Sonne und Tod, Dir, auch mir, und uns allen, mein
Kind!
Wendest die Augen zum Licht und zum Schein – Blind –so gehen wir und gehen allein,
Schlaf, es sind soviel Sonnen noch dein, Keiner kann Keinem Gefährte hier sein
Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein. Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf
ein!
Schlaf mein Kind und horch nicht auf mich! Schläfst du, Mirjam? – Mirjam, mein
Kind,
Sinn hat’s für mich nur, und Schall ist’s für dich. Ufer nur sind wir, und tief in uns
rinnt
Schall nur, wie Windeswehn, Wassergerinn, Blut von Gewesenen – zu Kommenden
rollt’s,
Worte – vielleicht eines Lebens Gewinn! Blut unserer Väter, voll Unruh und
Stolz.
Was ich gewonnen grabt mit mir ein, In uns sind Alle. Wer fühlt sich allein?
keiner kann Keinem ein Erbe hier sein – Du bist ihr Leben – ihr Leben ist
dein—
Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein! Mirjam, mein Leben, mein Kind –
schlaf ein![2]
Was im vergangenen Semester mit der Untersuchung des „anderen Genies“ die Entwicklungsgeschichte von Frauen betraf, was auch in deren Vaterbeziehung und in deren Mut, sich aus Herkunftszwängen zu lösen, als Umsetzung kreativer Freiheit gedeutet werden konnte, lässt sich nicht generalisieren. Trotzdem ist es zulässig zu sagen, dass dem anderen Geschlecht hinsichtlich des väterlichen Erbes andere Möglichkeiten zustehen als Söhnen, die das väterliche Geschlecht fortsetzen und denen unter dem Blick des Vaters das eigene Bild übertragen wird, sei es als ungenügenden Abkömmling (Kafka), sei es als Rivalen, der zum Opfer oder zum überlegenen, überlebenden Sieger wird, sei es als gleichberechtigter Nachkomme, der sich nicht der Machtkonkurrenz ausgesetzt fühlt und daher ihrer nicht bedarf. Dass der gleichzeitig auf den Söhnen ruhende Blick der Mütter wie auch jener der Schwestern von grossem Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbildes und späterer Beziehungen ist, zeigt sich deutlich in der Auseinandersetzung mit Freuds persönlicher Geschichte. Diese führt eine Spur weiter.
Bevor wir darauf eingehen, erscheint es mir von Interesse zu sein, unter den vielen Nebenspuren, die mit Freud verknüpft sind, einer nachzugehen, in welcher die Frage der Wahlvaterschaft näher betrachtet werden kann.
„Neunzehn Jahre, (…), ein schmaler Junge, der bald stirbt. Das ist seine Geschichte.
Sie fängt beim Vater an – alle Menschengeschicke fangen bei Vätern an.“[3]
Als Arnold Zweig[4] 1931 den Band „Knaben und Männer“ veröffentlichte, stand er seit vier Jahren im Briefaustausch mit Sigmund Freud. Erst hatte er ihn mit „Sehr geehrter Herr Professor Freud“ angesprochen und ihn demütig angefragt, ob er ihm sein Buch „Caliban oder Politik und Leidenschaft“[5] widmen dürfe; wenig später begannen die Briefe mit „Sehr verehrter und geehrter Herr Freud“, am 11. Dezember 1931 das erstemal mit „Lieber Herr und Vater Freud“, schliesslich am 16. November 1932 mit „Lieber Vater Freud“, später auch mit „Liebster, verehrter Vater Freud“. Der mit Bewunderung und Hingabe erkorene Vater akzeptierte den dreissig Jahre jüngeren Schriftsteller nach einigem Zögern. Da er jedoch nicht zu den eigentlichen „Schülern“ und nicht zur „Vereinigung“ gehörte, beanspruchte er ihm gegenüber wenig Bevormundung. Auch traten kaum Rivalisierungsängste auf. Jede Art von Gedankenaustausch wurde offen zugelassen wurde, und mit den Gedanken die Vielzahl von Empfindungen, die mit den Arbeitsprojekten, den körperlichen Beschwernissen und den für beide zunehmend schwierigeren Lebensbedingungen zusammenhingen. Freud bezeichnete ihn jedoch nicht als Sohn, sondern nannte ihn „Meister“ – „Meister Arnold“ und beendete jeden Brief mit „Ihr Freud“, gegen Ende seines Lebens mit „Ihr getreuer Freud“. Als ein Symbol, das dem geistigen Erbe von Goethes Wahlverwandtschaft entsprach, hatte er ihm aus den persönlichen Sammelobjekten erst drei griechische Goldmünzen, dann einen Ring geschenkt (Anfang September 1937) , den Arnold Zweig fortan ständig trug. Als Arnold Zweig am 4. April 1938 per Telegramm erfuhr, dass die Flucht seines „liebsten Vaters“ aus dem von der Gestapo kontrollierten Wien endlich zustande kam – „Leaving today for 39, Elsworth Road, London N.W. 3. Affect. Greetings, Freud“ -, antwortete er am selben Tag mit dem Achtzeiler, der dem ganzen Briefwechsel bei dessen Veröffentlichung vorangestellt wurde und dessen Vielschichtigkeit einen grossen Fächer an Deutungen zulässt. Er schrieb
„Dem Vater Freud:
Was ich war, bevor ich
Dir begegnet,
Steht in diesen Seiten
mannigfalt.
Welches Leben war wie
Deins gesegnet?
Welches Wissen hat wie
Deins Gewalt?“
Bevor Arnold Zweig[6] zum „sohnhaft liebenden“[7] Vertrauten Sigmund Freuds wurde, hatte er mehrere Lebensetappen durchgestanden, die ihn, wie man annehmen könnte, längst ins Erwachsenenalter katapuliert hatten. Er war 40 Jahre alt und selber Vater von zwei Söhnen, hatte den Ersten Weltkrieg an der Front durchgestanden und war als kritischer Denker und Schriftsteller zugleich erfolgreich und angefeindet, als mit der Veröffentlichung von „Caliban“ der Briefwechsel mit Sigmund Freud und damit eine zwölf Jahre dauernde Beziehung begann, die ein vielfältiges Lebensgeflecht bedeutete. Es war vier Jahre später, nach Freuds 75. Geburtstag, dass er durch die Anrede „Lieber Herr und Vater Freud“ das massgebende Bedürfnis nach einer nicht mehr lösbaren Bindung kund tat. Warum „Vater Freud“? Arnold Zweig war in diesem Brief vom 11. Dezember 1931 auf den vor zweieinhalb Jahren verstorbenen Hugo von Hofmannsthal[8] sowie auf den knapp vor zwei Monaten in Folge einer Hirnblutung plötzlich hinweggerafften Arthur Schnitzler[9] eingegangen, über dessen Tod er noch zu niemanden kein Wort habe sagen können, „denn er ähnelte meinem Vater körperlich, nur dass mein Vater ein bäurischer Jude war, und sein ‚Weg ins Freie’’ hat mir einmal mehr bedeutet als die anderen Erzeugnisse Schnitzlers und seiner Generationsgenossen.“[10]
Vieles ging mit dem Vergleich einher, sowohl die Erinnerung an den eigenen Vater und an dessen „bäuerische“, wohl erdnahe und zugleich offene Bereitschaft, ihm das eigene Leben und ein befreiendes, sich aus jeglicher Getto-Einklammerung lösendes Wachstum zu ermöglichen, wie gleichzeitig der Gedanke des Todes, waren doch Hofmannsthal und Schnitzler je 18 resp. 8 Jahre jünger gewesen als Freud und beide infolge eines plötzlichen Herzversagens gestorben. Erhoffte sich Arnold Zweig, der in der Lebensmitte war und sowohl unter seiner Myopie wie unter den politischen Entwicklungen in Deutschland litt, durch welche er sich in seiner Identität als Deutscher – als jüdischer Deutscher – ähnlich bedroht fühlte wie von einer schleichenden Krankheit, erhoffte er sich mit Freud, der seit acht Jahren – seit 1923 – eine schwere Krebserkrankung und damit einhergehende Gaumen- und Kieferoperationen zu ertragen hatte, einen dem Tod überlegenen, gottähnlichen Vater? Wünschte er sich das Recht zuzugestehen, eine neue Art Sohn zu sein, d.h. selber wieder auf kindhafte Weise geliebt und im täglich erforderten Mut unterstützt zu werden? – Brauchte er, der den eigenen zwei Söhnen gegenüber als Vorbild und Lehrmeister zu wirken hatte, jedoch immer wieder der Mutlosigkeit und schwerer Depression anheimfiel, der väterlichen Bestätigung, von analogem Wert zu sein wie er? War er sich des übergriffigen Besitzanspruchs, der mit seinen Wünschen einher ging, bewusst? Tatsächlich öffnete sich hinter Arnold Zweigs „Vater Freud“ unausgesprochen, jedoch vielfältig spürbar ein Fächer von Bedürfnissen.
Wie reagierte Freud darauf? Einerseits war er Arnold Zweig wohlgesinnt, wie er schon am 21. August 1930 zum Ausdruck brachte, als er dessen Glückwünsche zum Goethepreis, den die Stadt Frankfurt Freud zugesprochen hatte und den seine Tochter Anna an seiner Stelle entgegennahm, als die „ergreifendsten“ unter den vielen Glückwünschen bezeichnete. „Beim Durchlesen Ihrer Zeilen machte ich die Entdeckung, dass ich mich nicht viel weniger gefreut hätte, wenn man Ihnen den Preis gegeben hätte, und bei Ihnen wäre er eigentlich besser am Platz gewesen. Aber Ihnen steht gewiss viel Ähnliches bevor.“[11] Freud, der bis anhin von Arnold Zweig als „Herr Professor“ angesprochen worden war, hatte fälschlicherweise mit „Lieber Herr Doktor“ geantwortet, worauf Arnold Zweig, der trotz seines ausgedehnten Studiums keinen Doktortitel erworben hatte, beschloss, auch beim verehrten alten Freud die akademische Titelbezeichnung wegzulassen. Bedurfte er anstelle des Professors eines anderen, ebenbürtigen Titels – jenes des Vaters -, um gleichzeitig emotionale Nähe und Distanz an Wissen, auf jeden Fall Abhängigkeit zum Ausdruck zu bringen? Und wünschte Freud mit dem zwei Jahre später zugesprochenen „Meister“-Titel die Verwechslung von Arnold Zweig mit Stefan Zweig und dessen Doktortitel zu korrigieren, die er im Brief vom 10. September 1930 als „von unbekannten Mächten bewirkte Fehlleistung“ bezeichnete, die „als Störung den anderen Zweig aufzeigte (…). Er hat mir im letzten Halbjahr einen starken Grund zur Unzufriedenheit gegeben, meine ursprüngliche starke Rachsucht ist jetzt ins Unbewusste verbannt, und da ist es ganz gut möglich, dass ich einen Vergleich anstellen und eine Ersetzung durchführen wollte.“ [12] Noch beantwortete er Zweigs Briefe weiter mit dem konventionellen „Lieber Herr Zweig“, und als er am 8. Mai 1932, d.h. im fünften Jahr der Korrespondenz, nachdem Arnold Zweig sich erneut seines Geburtstags erinnert und ihm ein „beschwerdeloses Jahr“[13] gewünscht hatte, die Anrede änderte und ihn mit „Lieber Meister Arnold“ ansprach, ging er in keiner Weise mehr auf die Titel- und Personenverwechslung ein. Im darauf folgenden Brief vom 18. August des gleichen Jahres ergänzte er bloss „Ich glaube, der Name soll Ihnen bleiben“.[14] Sollte Arnold Zweig dadurch das Gefühl vermittelt werden, die „Meister“-Prüfung bestanden zu haben?
Auf jeden Fall verdichtete sich der wechselseitige Austausch an Überlegungen, an Selbstbefragung, an Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher und literarischer Arbeit, mit gesundheitlichen Problemen und Verlusten, mit den Tatsachen des anwachsenden Nationalsozialismus sowie mit der Klage Arnold Zweigs über die araberfeindliche, militarisierte und in sprachlicher Hinsicht einseitig auf Ivrit reduzierte Entwicklung des Zionismus in Palästina. Freuds Arbeit am dritten Teil des Moses, letztlich der gewagteste und klarste seiner späten persönlichen Auseinandersetzung mit der jüdischen Vatergeschichte, in die er Arnold Zweig miteinbezog, ging einher mit der zunehmenden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Dazu kam der Einmarsch Hitlers in Wien am 11. März 1938, der die Übersiedlung Sigmund und Martha Freuds sowie Anna Freuds nach London am 4. Juni 1938 mit grosser Dringlichkeit verursachte.
Schon am 2. April 1937 hatte Freud an Arnold Zweig geschrieben „Mein hereditärer Lebensanspruch[15] läuft, wie Ihnen schon bekannt, im November ab. Ich möchte gern Garantien bis dahin annehmen, aber länger möchte ich wirklich nicht verzögern, denn alles herum wird immer dunkler, drohender, und das Bewusstsein der eigenen Hilflosigkeit immer aufdringlicher.“[16] Von Seiten Arnold Zweigs wuchs die Sorge um den „liebsten Vater“ an und er teilte sie ihm mit, „denn Sie müssen daran denken, dass wir ohne Sie eine Herde ohne den Hirten sind und ein Kinderstall ohne Vater, um es biblisch auszudrücken.“[17] Im Oktober 1938 hatte Arnold Zweig es geschafft, von Haifa über Frankreich nach London zu gelangen, um seinen „liebsten Vater“ zu sehen. Doch die Begegnung war eher Bestätigung der Fremdheit als der Nähe. „Es war Ihnen gewiss anstrengend und mir schmerzlich, Ihnen so ungeordnet und überstopft gegenübertreten zu müssen. (Dieser Satz ist nicht ganz in Ordnung, also richtig). Aber ich habe es an Arbeit nicht fehlen lassen, mein Inneres besser aufzuräumen und ich werde es auch weiter tun. Und nun fühle ich beglückt, (…) dass die unablässige Urteilskraft, die Ihnen eignet, wieder an einem eigenen Schreibtisch arbeitet, (…) und dass Ihr Herz, Ihre grosse stumme Liebe, Ihr grosses stummes Leiden an unseren unselig zwiespältigen Menschen eingerahmt wird von Ihrem neuen, verjüngten Heim.“[18]
Zurück in Haifa fühlte sich Arnold Zweig zunehmend entmutigt. „Ich finde es sinnlos, weiter Werke auf so schaurigem Hintergrund loszulassen. Es ekelt einen so. Ich fürchte, das Maschinen-Zeitalter hat die Insektenseele in der Menschheit reaktiviert, und der Kulturabschliff des Krieges hat sie zur Oberfläche gebracht. Ameisen und Termiten bereiten sich vor, den Globus zu überschwemmen. Die Demokratien benehmen sich dabei wie die Blattläuse: sie lassen sich melken.[19]
Eine zunehmende Entfernung zwischen Arnold Zweig und seinem Wahlvater wurde spürbar, es war, als ob die Worte sich aus dem innern Bezug gelöst hätten, als ob die Sprache nur noch Konstrukt war. Freud erlebte eine weitere Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes, Knochenstücke wurden abgestossen, die Schmerzen nahmen ständig zu, „kein Zweifel, dass es sich um einen weiteren Vorstoss meines lieben alten Carcinoms handelt, mit dem ich seit 16 Jahren die Existenz teile“[20]. Arnold Zweig hatte in Haifa einen schweren Autounfall überstanden und erholte sich langsam. Seinem „liebsten Vater Freud“ schrieb er am 23. März 1939 „Ich bin voller Fragen an Sie über Sie selbst, aber Scham und Scheu hinderten mich bisher und werden es wohl immer tun. Die Steinach-Operation, die Karzinom-Operation, die Jahre im resistenten Wien, das Erlebnis mit Jung, mit Stekel, mit Rank: all dies sind Dinge, von denen ich mehr hören möchte.“[21]
Warum hatte Arnold Zweig nicht früher Fragen gestellt? Hatte er sich für die inneren Konflikte des „liebsten Vaters Freud“ und dessen Auseinandersetzung mit sich selbst überhaupt interessiert? Von Freud traf keine Antwort mehr ein. Das Moses-Buch war erschienen. Arnold Zweig hatte ein Exemplar erhalten und es gleich gelesen. Er hatte erwartet, dass sein „Caliban“ darin zitiert würde. Dem todkranken „liebsten Vater“ machte er aus Enttäuschung eine knappe, freche Bemerkung. „Schade, dass Sie meinen ‚Caliban’ nirgends zitieren konnten; eine bestimmte Stelle ermutigt mich zu diesem leisen Vorwurf. Zur Strafe wird Adam Ihnen eine ‚Kritik’ des Moses aus der hebräischen Zeitung der Ganz Schwarzen (Agudath Jisrael) übersetzen.“[22]
Arnold Zweig bauschte sich gegenüber dem sterbenden „liebsten Vater“ als Rächer auf und zog den eigenen jüngeren Sohn als Instrument in dieses Machtspiel hinein. Einen Monat später, im Brief vom 9. September 1939, gab er zum Ausdruck, dass ein „Übermut“ ihn „gezwickt“ habe, als er ihm schrieb, er werde ihm „zur Strafe die Übersetzung der frechsten und unsinnigsten Kritik“ schicken. Doch weder Bedauern noch Entschuldigung fügte er bei, nur dass er sich gräme, nicht Arzt geworden zu sein.
Es war der letzte Brief, den der mit sich und seiner Zugehörigkeit hadernde „Sohn“ an seinen Wahlvater richtete, dessen qualvolles Leiden er ebenso wenig ertragen konnte wie seine eigene Hilflosigkeit. Am wenigsten konnte er ertragen, in seiner eigenen Eitelkeit nicht befriedigt worden zu sein, ihm grossen, abschliessenden Moses-Werk des „geliebten Vaters“ keine Erwähnung zu finden und damit auf sich selber gestellt zu sein.
War es der Mangel an Mut, jener tragenden und wärmenden Kraft des Herzens (franz. courage – coeur), die sich bei Arnold Zweig in deren Kehrseite äusserte, in „Übermut“, die seinem triebhaften Aufbegehren nach Macht die Hand bot. Der Beziehungskreis zwischen dem aufstrebungshungrigen Schriftsteller, der der väterlichen Unterstützung bedurfte, hatte mit „Caliban“ begonnen und endete mit „Caliban“. Was Arnold Zweig als „Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitismus“ als Untersuchung kollektiver, insbesondere deutscher Notwendigkeiten der Schuldüberwälzung eigenen Versagens und Mangels an Erfolg, der Feinderklärung und Hassübertragung erarbeitet und 1927 publiziert hatte, war durch die Titelwahl „Caliban“ mit kaum kontrollierbarer, triebgesteuerter Unterwerfungshaltung sowie der Projektion aggressiver Missgunst vernetzt. In der Vorrede zum Buch findet sich der Bezug zu Shakespeare’s Patenschaft[23], jedoch auch zum ihm selbst: … „ja sein Caliban war die Verkörperung des Triebwesens und zwar meines ‚Differenzaffekts“ selbst. Caliban lebt unterhalb von Gut und Böse – ein Bursche, bemitleidenswert, auch noch in seiner bellenden Bosheit. Lust, Zorn, Hass, Rache, Angst, abergläubisches Niederfallen vor dem Fetisch und eine Menge roher Gewalt regieren ihn. Es war der Differenzaffekt, kein Zweifel, den ich in der Gruppenseele festgestellt, aus dem Unbekannten heraufgeholt und wie ein Botaniker der Seelenflora beschrieben zu haben mir bestätigte. (…) Caliban sagte genug.“[24] War Arnold Zweig selber „bemitleidenswert“? Sigmund Freud starb am 23. September 1939.
Inzwischen war der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen – am 1. September 1939 – Realität geworden.
Die von Arnold Zweig angestrebte und von Sigmund Freud nach längerer Zurückhaltung zugestandene und wahrgenommene Wahlvaterschaft wurde nach dem Tod des „liebsten Vaters“ von Zweig nicht kritisch hinterfragt; ebenso wenig beschäftigte ihn die von ihm zu spät gestellte und nicht mehr beantwortbare Frage weiter, wie Freud mit seiner eigenen väterlichen Erbschaft umgegangen war und wie er seine eigenen Vaterschaften verarbeitet hatte. Wir werden diesen Fragen nun nachgehen, wenn gleich eine Klärung aus zeitlichen Gründen nur annähernd erfolgen kann.
Sigmund Freud war 40 Jahre alt, in der Lebensmitte (etwa im gleichen Alter wie Arnold Zweig, als dieser sich erstmals an ihn wandte), seit zehn Jahren verheiratet[25] und Vater von sechs Kindern[26], Privatdozent an der Universität Wien in Neuropathologie und allmählich ein angesehener Arzt, als er dem zwei Jahre jüngeren, von ihm bewunderten Wilhelm Fliess[27] schrieb, sein alter, 81jähriger Vater befinde sich „in Baden in einem höchst wackeligen Zustand, mit Herzkollapsen, Blasenlähmung und ähnlichem. Das Lauern auf Nachrichten. Reisen zu ihm und dgl. war eigentlich das einzig Interessante dieser zwei Wochen“. Ende Juni schreibt er an Fliess, dass sein Vater „wohl auf dem letzten Bett“ liege. Er selber wird darob krank und fühlt das eigene Leben in Gefahr, „eine Influenza mit Fieber, Eiter und Herzbeschwerden hat mein Wohlbefinden plötzlich gebrochen (…). Ich möchte so gerne bis zur berühmten Altersgrenze ca. 51 aushalten“. Den Tod des Vaters vom 23. Oktober 1896 teilte er dem Freund in einem kurzen Brief drei Tage später mit und ging am 2. November 1896 näher auf die Gefühle ein, die dadurch ausgelöst wurden: „Auf irgendeinem dunkeln Weg hinter dem offiziellen Bewusstsein hat mich der Tod des Alten sehr ergriffen. Ich hatte ihn sehr geschätzt, sehr genau verstanden, und er hatte viel in meinem Leben gemacht, mit der ihm eigenen Weisheit und phantastisch leichtem Sinn. Er war lange ausgelebt, als er starb, aber im Inneren ist wohl alles Frühere bei diesem Anlass aufgewacht. Ich habe nun ein recht entwurzeltes Gefühl.“[28]
Tatsächlich beanspruchte der Tod des Vaters Sigmund Freud zutiefst seine emotionalen Kräfte. Ein Traum, den er in der Nacht nach dem Begräbnis seines Vaters hatte und den er Wilhelm Fliess im Brief vom 2. November 1896 erzählte, auch im VI. Kapitel der „Traumdeutung“ wieder aufnahm und in der Darstellung erweiterte[29], lässt einen Teil davon deutlich werden. Die Herkunftsgeschichte, d.h. das Verflochtensein mit Vater und Mutter und deren Geschichte, sowie seine eigene Entwicklung erlebte eine grundlegende Veränderung im Erkunden der Zusammenhänge. Er erkannte die Bedeutung der im Unbewussten gespeicherten Erfahrungen, die sich in einer geheimen Sprache in den Träumen äussern und der Deutung bedürfen. Freud grossartige Theorie der Traumanalyse, die er im Jahr 1900 erstmals veröffentlichte, die jedoch kaum Beachtung fand, nahm hier ihren Anfang. Im Vorwort zur zweiten Auflage der „Traumdeutung“ von 1908 hielt er fest: „In den langen Jahren meiner Arbeit an den Neurosenproblemen[30] bin ich wiederholt ins Schwanken geraten und an manchem irre geworden; dann war es immer wieder die ‚Traumdeutung’, an der ich meine Sicherheit wiederfand. (…) Auch das Material dieses Buches (…) erwies bei der Revision ein Beharrungsvermögen, das sich eingreifenden Änderungen widersetzte. Für mich hat dieses Buch nämlich noch eine andere subjektive Bedeutung, die ich erst nach seiner Beendigung verstehen konnte. Es erwies sich mir als ein Stück meiner Selbstanalyse, als meine Reaktion auf den Tod meines Vaters, als auf das bedeutsamste Ereignis, den einschneidendsten Verlust im Leben eines Mannes. Nachdem ich dies erkannt hatte, fühlte ich mich unfähig, die Spuren dieser Einwirkung zu verwischen.“[31]
Der Traum, der vermutlich in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1896 nach dem Begräbnis des Vaters folgte, handelte von einer Tafel oder einem Plakat, analog zu jenen, auf denen in den Wartesälen der Eisenbahnen das Verbot zu rauchen stand, stand mit der Inschrift:
„Man bittet, die Augen zuzudrücken
oder
Man bittet, ein Auge zuzudrücken“[32]
Freud hielt fest, dass beide Fassungen einen besondern Sinn haben: die erste bezieht sich auf die heilige Pflicht des Sohnes, die er dem verstorbenen Vater Kallaman Jacob Freud gegenüber zu erfüllen hatte und die er erfüllt hatte; die zweite auf einen Wunsch, der sich an die übrigen Familiemitgliedern richtete, ihn nicht zu bewerten, sondern Nachsicht zu üben, weil er gegen ihren Willen eine einfache Begräbnisfeier organisiert hatte und mit Verspätung dort angelangt war. Diesem Wunsch lag somit ein unbewusstes Schuldgefühl zugrunde.
Dass der Traum zugleich Gegensätzliches und Widersprüchliches an Aussagen enthielt und dass beides zutraf, war für Freud eine wichtige Erkenntnis.
Tatsächlich war er seiner Sohnespflicht dem verstorbenen Vater gegenüber gerecht geworden, der selber ihm gegenüber nachsichtig und grosszügig gewesen war, der ihm nahe stand und gleichzeitig in seiner väterlichen Bedeutung unerreichbar blieb. Unerreichbar war er durch die Anzahl von Söhnen und Töchtern, die er gezeugt hatte. Sigmund Freud, am 6. Mai 1856 unter dem Namen Sigismund Schlomo geboren (offiziell in Sigmund verkürzt, als er 22 Jahre alt war), war der Älteste von acht Kindern[33] aus der dritten Ehe seines Vaters. Da waren noch die Söhne aus der ersten Ehe des Vaters mit Sally Kanner, die nicht mehr lebte[34]: der schon verheiratete Emanuel, der ein Jahr älter und Philipp, der gleichaltrig war wie Amalia Malka Nathanson (geb. 1835), die Mutter Sigmund Freuds und seiner Geschwister, die selber 20 Jahre jünger war als ihr 40jähriger Ehemann, der Wollhändler Jacob Freud, der im mährischen Freiberg (heute tschechisch Pribor) in den ersten drei Jahren des gemeinsamen Lebens einigen Wohlstand erreichen konnte, der jedoch keine kaufmännische Begabung hatte. Er war ein grossgewachsener, nachdenklicher Mann, der „aus chassidischem Milieu stammte, (jedoch) seinen heimatlichen Beziehungen seit fast zwanzig Jahren entfremdet war“ (wie Freud 1930 an einen amerikanischen Schriftsteller schrieb, mit dessen biografischem Kommentar er unzufrieden war)[35], der zwar noch Hebräisch las, jedoch in religiöser Hinsicht so aufgeschlossen war, dass er seinen Sohn „unjüdisch erzog“, wie Freud im gleichen Brief festhielt. Zwei Wochen nach der Heirat mit Amalia kam John, der Sohn Emanuels und dessen Frau Marie, zur Welt, so dass Jacob Freud Grossvater war, noch bevor sein Sohn Sig(is)mund geboren wurde, und dieser war in den ersten drei Jahren als John’s nächster Freund und Rivale zwar neun Monate jünger als er, aber gleichzeitig sein Onkel.
Die an Tuberkulose erkrankte Mutter Freuds befand sich häufig zur Kur in Roznau, so dass noch eine Kinderfrau in den engen Haushalt beigezogen werden musste, Monika Zajic, die zur Familie des katholischen Hausbesitzers gehörte. Für den Knaben war es ein schwer durchschaubares Familiengefüge. Er dachte, dass Jacob, sein Vater, eher als Grossvater zu betrachten war und mit der Kinderfrau Monika auf einer Ebene stand, und dass Philipp derjenige war, der seiner Mutter Amalia am nächsten stand und ihr sowohl den kleinen Bruder Julius, der sechs Monate nach der Geburt starb[36], wie auch die kleine Schwester Anna in den Bauch gesetzt hatte, die wieder ein Jahr später zur Welt kam und bei Sig(is)mund ein Gefühl von Unmut, Unklarheit und Eifersucht weckte. “Das noch nicht dreijährige Kind hat verstanden, dass das letzthin angekommene Schwesterchen im Leib der Mutter gewachsen ist. Es ist gar nicht einverstanden mit diesem Zuwachs und (…) wendet sich (…) an den grossen Bruder, der (…) an Stelle des Vaters zum Rivalen des Kleinen geworden ist. Gegen diesen Bruder richtet sich (…) der (Verdacht), dass er irgendwie das kürzlich geborene Kind in den Mutterleib hineinpraktiziert hat.“ [37]
Wer nahm den Platz ein, den der Knabe einzunehmen wünschte, wer stand der Mutter am nächsten? Dass im Alltag trotz allen Vermutungen des Sohnes nicht Philipp, sondern Jacob mit der Mutter im gleichen Bett schlief, war nicht zu verstehen[38]. All dies gehörte zu den rätselhaften Unklarheiten rings um die Autorität des Vaters und um das Recht der Nähe zur Mutter, wie Freud sie als wichtigen Teil im „Familienroman der Neurotiker“ ausführte: „(…) das Kind begreift, dass ’pater semper incertus est’, während die Mutter ’certissima’ ist. So erfährt der Familienroman eine eigentümliche Einschränkung: er begnügt sich nämlich damit, den Vater zu erhöhen, die Abkunft von der Mutter aber als etwas Unabänderliches nicht weiter in Frage zu stellen.“[39]
Doch wie mächtig war Jacob, der Vater? Gewiss erschien er dem Kind nicht nur mächtig, sondern auch ohnmächtig, doch der Zweifel an der Macht des Vaters musste ständig verdrängt werden. Ein Beispiel war, dass Jacob nicht verhindern konnte, dass die Kinderfrau Monika von Philipp des Diebstahls angeklagt wurde, weil bei ihr „die blanken Kreuzer, Zehnerl und Spielsachen“ gefunden wurden, die, wie es hiess, dem zwei Jahre und acht Monate alten Sigmund entwendet worden seien, worauf sie für zehn Monate ins Gefängnis kam und dem Kind als Ersatzmutter (oder Ersatzgrossmutter) entrissen wurde. Ein weiteres Beispiel von Jacobs Ohnmacht war, dass er vor den Augen seines kleinen Sohns durch einen antisemitischen Mitbürger gedemütigt wurde (er musste ihm auf dem Gehsteig den Platz einräumen, der Hut wurde ihm vom Kopf in den Schmutz geschlagen und er musste sich bücken, um ihn wieder aufsetzen), schliesslich dass er, als 1857 die grosse Wirtschaftskrise einsetzte, sein Vermögen verlor und wenig später, 1859, mit seiner Familie zuerst nach Leipzig und kurz darauf nach Wien ziehen musste. Der Vater konnte nicht verhindern, dass Sig(is)mund fast gleichzeitig seine Kinderfrau und sein ländliches, vertrautes Umfeld entzogen wurde, dass er in die Eisenbahn gesetzt wurde und unterwegs nach Leipzig, in Breslau, eine schwere Feuersbrunst erlebte, dass er als Kind erlebte, was es bedeutet, in einer Grossstadt Fremder zu sein – und arm.
Die Armut setzte sich fort und belastete Freud sehr, sowohl in der Schul- und Studienzeit wie auch später, als er als junger Arzt zu wenig Einkommen hatte und Geld leihen musste (z.B. bei Josef Breuer), um seine eigene grosse Familie mit den eigenen sechs Kindern sowie die mittellosen, unverheirateten Schwestern und seine Eltern zu ernähren. Die bescheidene Begräbnisfeier für den verstorbenen Vater, den er ehren und keineswegs entehren wollte, hängt mit de Fortsetzung des Auszugs aus Freiberg zusammen.
Die vielen Träume, die nach dem Tod des Vaters einsetzten und für Freud erinnerbar blieben – so wie er sie Wilhelm Fliess erzählte und in die „Traumdeutung“ einbezog – , machen deutlich, wie komplex und widersprüchlich seine Beziehung zur Vaterfigur gewesen war und dass auch die frühkindliche Beziehung zur Mutter, die er immer wieder vermisste und deren Nähe er ersehnte, ein wichtiger Teil dieser Komplexität war. Das vielfältige Geheimnis um die Sexualität, um die triebhafte Lust und Zeugungsmacht des „coitus“ war durch die Familiengeschichte geweckt worden und wurde gleichzeitig tabuisiert, wodurch noch grössere Neugier und noch stärkere Wünsche angeregt wurden, Wünsche nach dem Besitz der unzugänglichen Mutter und geheime Todeswünsche dem Vater gegenüber.
Wie Ernest Jones festhielt, „weist alles darauf hin, dass Freuds bewusste Haltung gegenüber seinem Vater, obwohl dieser Autorität und Versagen verkörperte, durchwegs eine zärtliche, bewundernde und respektvolle war. Feindselige Regungen waren völlig auf Philipp und Emanuel verschoben. Es erschütterte Freud daher tief, als er vierzig Jahre später ‚die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater’ und damit ‚die packende Macht des Königs Ödipus bei sich entdeckte und sich eingestehen musste, dass sein Unbewusstes sich dem Vater gegenüber ganz anders eingestellt hatte als sein Bewusstes.“ [40] Freud selber hielt in seiner Betrachtung über die Bedeutung des Mythos fest, dass „ (König Ödipus’) Schicksal uns nur darum ergreift, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten; unsere Träume überzeugen uns davon. König Ödipus, der den Vater Laïos erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. (…) Wie Ödipus leben wir in Unwissenheit der die Moral beleidigenden Wünsche, welche die Natur uns aufgenötigt hat, und nach deren Enthüllung möchten wir wohl den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit.“[41]
Die Aufarbeitung seiner Vaterbeziehung als Sohn war Sigmund Freud dank der „Traumdeutung“, dank der Auseinandersetzung mit der „Psychopathologie des Alltags“ und mit „Totem und Tabu“ in weitem Mass gelungen. Die Konfrontation mit seiner eigenen Macht und Ohnmacht als Vater sowie als „Vater“gestalt für seine Schüler und Schülerinnen, Anhänger und Nachfolger wie auch deren Klärung erfolgte von Freud selber au fur et à mesure. Nur wenig davon konnten wir im Lauf dieser Vorlesung berühren.
Als Freud seine in mehreren Etappen vorgenommene Aufarbeitung des „Mannes Moses und der monotheistischen Religion“ 1934 für eine Publikation zu ordnen und niederzuschreiben begann, fühlte er sich in seinen Kräften eingeschränkt. Neben Erfreulichem – endlich eine grössere Anerkennung seiner Publikationen[42] und eine beachtliche Ausweitung der Psychoanalyse nach London und Paris[43], die Ehrung durch den Goethepreis im August 1930 und ein Jahr später durch seine Herkunftsstadt Freiberg-Pribor, die ihn noch stärker berührte[44], die zunehmend stellvertretende Präsenz durch seine Tochter Anna sowohl im Wiener „Comité“ wie an Kongressen -, hatte er viel Bedrückendes und Belastendes erlebt. Sein Gesundheitszustand ging seit den ersten Kieferkrebsoperationen von 1923 in Wien mit ständigen Schmerzen sowie wachsenden Einschränkungen und qualvollen Komplikationen einher, die immer wieder neue Operationen (in Berlin, schliesslich in London) nach sich zogen; zahlreiche ihm nächst- und nahestehende Menschen waren gestorben, Anfang September 1930 auch seine Mutter, deren Tod – anders als der Tod seines Vaters – „merkwürdig auf mich gewirkt hat, dies grosse Ereignis. Kein Schmerz, keine Trauer, was sich wahrscheinlich aus den Nebenumständen, dem hohen Alter, dem Mitleid mit ihrer Hilflosigkeit am Ende erklärt, dabei ein Gefühl der Befreiung, der Losgesprochenheit, das ich auch zu verstehen glaube. Ich durfte ja nicht sterben, solange sie am Leben war, und jetzt darf ich. Irgendwie werden sich in tieferen Schichten die Lebenswerte merklich geändert haben“[45], wie er Sandor Ferenczi, dem nächsten unter seinen Schülern, schrieb, der selber drei Jahre später, im Mai 1933, nach zunehmender angstbesetzter Umnachtung starb.
In der gleichen Zeit verfinsterte sich die politische Entwicklung in Deutschland und in Österreich, der Antisemitismus wurde nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933 von Tag zu Tag gewalttätiger, bedrückender und verhängnisvoller, da er nicht mehr gesetzeswidrig war, im Gegenteil; es kam zu immer weiteren Restriktionen, Publikationsverboten und schliesslich 1934 zu den Bücherverbrennungen, auch zur Verbrennung von Freuds Büchern in Berlin. Marthe Robert hält dazu fest: „Er nahm es zur Kenntnis und zitierte, ’er hörte auf die Welt zu verstehen!’ Seine Meinung war es, dass dieses barbarische Schauspiel nicht mehr sei als ein Symbol. Er ahnte nicht, dass dies der Auftakt zur tatsächlichen Austilgung (zur Verbrennung) seines Volkes war und dass zwölf Jahre später seine vier Schwestern, die er in Wien zurückgelassen hatte, auch unter den Millionen von Opfern sein würden.“[46]
Brauchte Freud die Grösse und Tragik der legendären Mosesgestalt, um sich selber in der sich für das jüdische Volk anbahnenden Tragik zu positionieren, als Sohn und als Vater, als Jude und als frei denkender Mensch, der den Mut hatte, eine neue Lehre aufzubauen, ja zu verkünden? „Angesichts der neuen Verfolgungen“ schrieb er am 30. September 1934 an Arnold Zweig „fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und warum er sich diesen unsterblichen Hass zugezogen hat“.[47] Es muss ein zugleich drängendes und ängstigendes Bedürfnis nach Klärung der Frage gewesen sein, das ihn bewog, der Quelle der Moses-Geschichte und der monotheistischen Religionen, insbesondere des Judentums nachzugehen, und es müssen widersprüchliche Energien in Freud gewirkt haben, die ihn bewogen, immer wieder Erarbeitetes zu überprüfen – insbesondere im dritten Teil – und neu zu formulieren, bis er sich zur Publikation entschliessen konnte.
So griff er in der dreiteiligen Abhandlung die Auseinandersetzung mit dem grossen Vater-Mythos auf wie mit der sich über Jahrhunderte fortsetzenden und ausweitenden Schuld der Söhne, die danach trachteten, sich über den Vater zu erheben. Betraf es nicht ihn selber, zugleich als Sohn seines Vaters Jacob (gemäss der biblischen Urvätergeschichten ist Jacob, wie in der 1. Vorlesung erwähnt, der Vater von zwölf Söhnen, die als die Stammesväter Israels gelten und zu denen Joseph, der zweitjüngste gehört, dessen Volk von Moses, dem ägyptischen Prinzen und charismatischen Verkünder des einen Gottes, aus Ägypten geführt wurde) wie als Vater sowohl seiner leiblichen sechs Kinder[48] wie der grossen Anzahl von „Söhnen“, die sich gegen ihn als ihren Stammesfürsten aufgelehnt hatten mit der Absicht, ihn zu verstossen? Auch wenn Freud nicht gläubig war, war er Teil dieses Volkes und dessen Geschichte, und obwohl er die Beziehung zu seinem eigenen Vater nach dessen Tod durch seine Selbstanalyse gut aufgearbeitet hatte, blieb in ihm immer noch ein Teil des Schuldgefühls haften, wie er noch im Januar 1936 festhielt, als er auf seine Empfindungen anlässlich der 1904 mit seinem Bruder Alexander realisierten Reise nach Athen und auf die Akropolis einging: „Es muss so sein, dass sich an die Befriedigung, es so weit gebracht zu haben, ein Schuldgefühl knüpft; es ist etwas dabei, was unrecht, was von alters her verboten ist. Das hat mir der kindlichen Kritik am Vater zu tun, mit der Geringschätzung, welche die frühkindliche Überschätzung seiner Person abgelöst hatte. Es sieht aus, als wäre es das Wesentliche am Erfolg, es weiter zu bringen als der Vater, und als wäre es noch immer unerlaubt, den Vater übertreffen zu wollen.“[49]
Was bei Sigmund Freud den inneren Zwiespalt bewirkte, mag ein Restbestand des alten Schuldgefühls gewesen sein, selbst in Sachen Religion mehr Wissen anzustreben als der Vater sich zumuten konnte, und zugleich trotz schwerstem körperlichen Leiden und existentieller Ungewissheit eine nicht nachlassende Erkenntnislust zu spüren, die wie ein loderndes, diagnostisches Feuer die Verzweiflung ob dem Judentum und das Restchen Liebe, das er dieser nicht gewählten Herkunft gegenüber empfand, zu erhellen trachtete. Schon am 4. Mai 1932 hatte er Arnold Zweig geschrieben: „Palästina hat nichts gebildet als Religionen, heiligen Wahnsinn, vermessene Versuch, die äussere Scheinwelt durch die innere Wunschwelt zu bewältigen, und wir stammen von dort (…), unsere Vorfahren haben dort vielleicht durch ein halbes Jahrtausend, vielleicht durch ein ganzes gelebt (aber auch dies nur vielleicht), und es ist nicht zu sagen, was wir vom Leben in diesem Land als Erbschaft in Blut und Nerven (wie man fehlerhaft sagt) mitgenommen haben. Oh, das Leben könnte sehr interessant sein, wenn man nur mehr davon wüsste und verstünde. Aber sicher ist man nur seiner augenblicklichen Empfindungen!“[50]
In der qualvollen Wartezeit bis die Gestapo nach Hausdurchsuchungen und Konfiskationen sowie langen, mühsamen Befragungen und Verhandlungen (bei denen Anna Freud den schwierigsten Teil auf sich nahm), nach wichtigen Interventionen aus dem Ausland, Bemühungen von Ernest Jones um Einreisevisa in England und Zahlungen von Kautionen, für welche Marie Bonaparte aus Paris ihre Hilfe anbot, endlich die Bewilligung für die Ausreise Freuds und seiner Familie aus Wien eintraf, in diesen letzten drei Monaten kam Freud zum Abschluss seiner grossen Untersuchung des väterlichen Erbes. Das grosse religiöse Tabu[51] um die von Moses dem einen Teil der Nachfolger Jacobs – dem Josefstamm – verkündete Vaterreligion, die sich bis ins Judentum unter dem Naziregime, ja bis in die heutige Zeit fortsetzte und in die hinein Sigmund Freud als Kind von Amalie Nathanson und Jacob Freud geboren worden war und die ihm anhaftete, Ungläubigkeit hin oder her, dieses Tabu wagte er anzutasten – und weit mehr, entgegen aller Verbote der Antastbarkeit und aller damit verflochtenen Ängste. Man muss sich vorstellen, wie viel Konzentration unter dem konstanten Schmerzzustand infolge des sich verschlimmernden Karzinoms[52] und gleichzeitig unter den existentiellen Schikanen und unabsehbaren politischen Bedingungen erfordert war, und zugleich wie viel Mut, um diese historische und analytische Zusammenfassung von schon Erarbeitetem und von neu Erkanntem zustande zu bringen – und zu publizieren; denn die Ergebnisse, zu denen Freud gelangte, waren kaum ein Trost für das jüdische Volk. Gleichzeitig waren sie ein hohes Wagnis hinsichtlich der zu erwartenden Reaktionen der katholischen Kurie. Doch für Freud selber entsprachen sie dem Befreienden, das mit dem Aufzeichnen von Erkenntnis einhergeht – ein Aussprechen war seit 1923, der ersten Operation, kaum mehr möglich. Freud wollte schriftlich festhalten, was ihm wichtig erschien – auch hier eine merkwürdige Analogie zu Mose, der ein „Stotterer“ war und deshalb der Zeichensprache, der Schrift, bedurfte. [53]
Kleine Ausschnitte können die Dringlichkeit, unter welcher Freud stand, belegen[54]:
„Es handelt sich um etwas Vergangenes, Verschollenes, Überwundenes im Völkerleben, das wir dem Verdrängten im Seelenleben des Einzelnen gleichzustellen wagen. In welcher psychologischen Form dies Vergangene während der Zeit seiner Verdunkelung vorhanden war, wissen wir zunächst nicht zu sagen. Es wird uns nicht leicht, die Begriffe der Einzelpsychologie auf die Psychologie der Massen zu übertragen, und ich glaube nicht, dass wir etwas erreichen, wenn wir den Begriff eines ‚kollektiven’ Unbewussten einführen. Der Inhalt des Unbewussten ist ja überhaupt kollektiv, allgemeiner Besitz der Menschen. Wir behelfen uns also vorläufig mit dem Gebrauch von Analogien. Die Vorgänge, die wir hier im Völkerleben studieren, sind den uns aus der Psychopathologie bekannten sehr ähnlich, aber doch nicht ganz die nämlichen. Wir entschliessen uns endlich zur Annahme, dass die psychischen Niederschläge jener Urzeiten Erbgut geworden waren, in jeder neuen Generation nur der Erweckung, nicht der Erwerbung bedürftig. (…)
Die Wiederkehr des Verdrängten vollzieht sich langsam, gewiss nicht spontan, sondern unter dem Einfluss all der Änderungen in den Lebensbedingungen, welche die Kulturgeschichte der Menschen erfüllen. (…) Der Vater wird wiederum das Oberhaupt der Familie, längst nicht so unbeschränkt wie es der Vater der Urhorde[55] gewesen war. Das Totemtier[56] weicht dem Gott in noch sehr deutlichen Übergängen. Zunächst trägt der menschengestaltige Gott noch den Kopf des Tieres, später verwandelt er sich mit Vorliebe in dies bestimmte Tier, dann wird dies Tier ihm heilig und sein Lieblingsbegleiter, oder er hat das Tier getötet und trägt selbst den Beinamen danach. Zwischen dem Totemtier und dem Gott taucht der Heros auf[57], häufig als Vorstufe der Vergottung. Die Idee einer höchsten Gottheit scheint sich frühzeitig einzustellen, zunächst nur schattenhaft, ohne Einmengung in die täglichen Interessen des Menschen. Mit dem Zusammenschluss der Stämme und Völker organisieren sich auch die Götter zu Familien, zu Hierarchien. Einer unter ihnen wird häufig zum Oberherrn über Götter und Menschen erhöht. Zögernd geschieht dann der weitere Schritt, nur einen Gott zu zollen, und endlich erfolgt die Entscheidung, einem einzigen Gott alle Macht einzuräumen und keine anderen Götter neben ihm zu dulden. Erst damit war die Herrlichkeit des Urhordenvater wiederhergestellt, und die ihm geltenden Affekte konnten wiederholt werden.
Die erste Wirkung des Zusammentreffens mit dem so lange Vermissten und Ersehnten war überwältigend und so, wie die Tradition der Gesetzgebung vom Berg Sinai sie beschreibt. Bewunderung, Ehrfurcht und Dankbarkeit dafür, dass man Gnade gefunden in seinen Augen – die Mosesreligion kennt keine anderen als diese positiven Gefühle gegenüber dem Vatergott. (…)“
Soweit erscheint Freuds Deutung von der rabbinischen[58] Theologie nicht weit entfernt zu sein. Auch hier handelt es sich um die von Moses an die „Grossen der Versammlung“, die „Väter“ überlieferte Lehre. „Die Schriftgelehrten haben die dazu notwendige Vollmacht oder Autorität, die sie von Moses herleiten: ’Mose empfing die (schriftliche und mündliche) Tora vom Sinaï her und überlieferte sie dem Josua, dieser den Ältesten, diese den Propheten, diese den Männern der Grossen Versammlung’, gemäss der ’Sprüche der Väter (1,1)’. Die ’Väter’ gehen weiter durch die gesamte Zeit des Zweiten Tempels und führen nahtlos in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach (Chr.)“.[59] Freud suchte jedoch keineswegs eine Annäherung an die rabbinische Deutung, im Gegenteil. Er wagte eine andere Deutung:
„Die Richtung dieser Vaterreligion war damit für alle Zeiten festgelegt, doch war ihre Entwicklung damit nicht abgeschlossen. Zum Wesen des Vaterverhältnisses gehört die Ambivalenz; es konnte nicht ausbleiben, dass sich im Lauf der Zeiten auch jene Feindseligkeit regen wollte, die einst die Söhne angetrieben, den bewunderten und gefürchteten Vater zu töten. Im Rahmen der Mosesreligion war für den direkten Ausdruck des mörderischen Vaterhasses kein Raum. Nur eine mächtige Reaktion auf ihn konnte zum Vorschein kommen, das Schuldbewusstsein wegen dieser Feindseligkeit, das schlechte Gewissen, man habe sich gegen Gott versündigt und höre nicht auf zu sündigen.“
Sigmund Freud erläuterte in der Folge, dass dieses Schuldgefühl, durch die Propheten ständig wach gehalten, zu einem „integrierenden Teil des religiösen Systems“ wurde. Da die auf Gott gesetzten Hoffnungen sich nicht erfüllten und es dem Volk schlecht ging, sei es nur möglich gewesen, „an der über alles geliebten Illusion festzuhalten, Gottes auserwähltes Volk zu sein“, indem die eigene Schuldhaftigkeit als Ursache für das Elend zu gelten hatte, und indem „die Gebote immer strenger, peinlicher und auch kleinlicher eingehalten werden mussten“. Freud hält fest, dass dadurch wohl „in Lehre und Vorschrift ethische Höhen“ erreicht worden seien, dass diese Ethik jedoch „ihren Ursprung aus dem Schuldbewusstsein wegen der unterdrückten Gottesfeindschaft“ nicht verleugnen könne. „Sie hat den unabgeschlossenen und unabschliessbaren Charakter zwangsneurotischer Reaktionsbildungen; man errät auch, dass sie den geheimen Absichten der Bestrafung dient.“
Was „geheim“ ist, entspricht dem Tabu, und was dem Tabu untersteht, geht mit einer Ansammlung von Verdrängtem einher, das jeder Zwangsneurose zugrunde liegt. Gemäss Freud, wie er hier ausführt, geht die Gläubigkeit mit der Befolgung all der strengen Gebote, Verbote und Rituale mit dem Beibehalten des Tabus einher. Die weitere Entwicklung – wie jede transgenerationelle Fortsetzung von Ängsten und von Unterwerfungshaltung – fasst Freud zusammen als eine Entwicklung, die über das Judentum hinaus ging und sich über alle Mittelmeervölker ausweitete – „als ein dumpfes Unbehagen, als eine Unheilsahnung“. Eine revolutionäre Stimmung breitete sich aus, ein Aufbruchbedürfnis setzte sich durch. „Die Klärung der bedrückten Situation“ geschah durch den Mut, den Jesus an den Tag legte, d.h. „sie ging vom Judentum aus“. Und es sei auch ein jüdischer Mann gewesen, Saulus aus Tarsus, der sich als römischer Bürger Paulus nannte, der erkannt habe, dass das so unglückliche Volk, das Gottvater getötet habe, sich „in der wahnhaften Einkleidung der frohen Botschaft: ‚Wir sind von aller Schuld erlöst, seitdem einer von uns sein Leben geopfert hat, um uns zu entsühnen’, die Versicherung hergestellt habe, dass das Opfer Gottes Sohn gewesen sei
Beachtenswert erscheint Freud, wie sich die neue Religion mit der alten Ambivalenz im Vaterverhältnis auseinander gesetzt habe. „Ihr Hauptinhalt war zwar die Versöhnung mit Gottvater, die Sühne des an ihm begangenen Verbrechens; aber die andere Seite der Gefühlsbeziehung zeigte sich darin, dass der Sohn, der die Sühne auf sich genommen, selbst Gott wurde neben dem Vater und eigentlich an Stelle des Vaters. Aus einer Vaterreligion hervorgegangen, wurde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem Verhängnis, den Vater beseitigen zu müssen, ist es nicht entgangen.“
Dass nur ein Teil des jüdischen Volkes die neue Religion annahm und mit diesem Teil auch „Ägypter, Griechen, Syrer, Römer und endlich auch Germanen“ sowie viele weitere Völker, während ein anderer Teil sich weigerte, bedeute jene “Scheidung“, die, laut Freud, die zunehmende Absonderung derjenigen, die noch heute Juden heissen, bewirkt hat. Dass es ihnen unmöglich war, „den Fortschritt mitzumachen“, entspricht laut Freud einer „tragischen Schuld, die sie auf sich geladen haben und wofür sie schwer büssen müssen“. Warum dies geschehen sei, bedürfe einer besonderen Untersuchung.
Worin liegt in psychoanalytischer Hinsicht die Bedeutung von Freuds Untersuchung über den „Mann Moses und die monotheistische Religion“? Worin lag die Dringlichkeit, ja der innere Zwang, worunter er bei der beinah geheim gehaltenen Niederschrift stand, die kaum Angst vor der Publikation bewirkt hätte, wenn er sie nicht als wissenschaftliche Untersuchung, sondern als „Familienroman“ [60] hätte erscheinen lassen. In „Totem und Tabu“ hatte er festgehalten, dass „die Grundlage des Tabu ein verbotenes Tun ist, zu dem eine starke Neigung im Unbewussten besteht. (…) Der Mensch, der ein Tabu übertreten hat, wird selbst tabu, weil er die gefährliche Eignung hat, andere zu versuchen, dass sie seinem Beispiel folgen. Er erweckt Neid; warum sollte ihm gestattet sein, was anderen verboten ist?“[61] Tatsächlich hatte er, Teil des verfolgten Volkes und selber dem Tod nahe, mit seiner Moses-Untersuchung gewagt, ein religiöses Tabu zu übertreten.
Nun, sich selber als Neurotiker zu verstehen, hatte Sigmund Freud seit seiner – während der Freundschaft mit Wilhelm Fliess begonnenen – Selbstanalyse nicht abgewehrt. Er war damals 40 Jahre alt, als sein Vater 1896 als Einundachtzigjähriger starb und seine jüngste Tochter Anna knapp ein Jahr alt war. Mit Hilfe der Traumdeutung das Erkennen des Unbewussten und Verdrängten, damit des Tabuisierten und Verbotenen, das jedes menschliche Empfinden, Verhalten und Handeln beeinflusst, zu ermöglichen und im Zusammenhang der grossen Mythen wie jenes des Ödipus, der in Unkenntnis seiner Vatergeschichte zum Mörder des Vaters und zum Ehemann seiner Mutter wurde, als Teil der nicht lösbaren Vatergeschichte und damit einhergehender, verdrängter Todeswünsche zu benennen, wurde für Freud zum ersten grossen Werk, mit dessen Publikation (1900) er sein Abweichen von der Schulmedizin, seinen Mut zum Aussenseitertum – und seine neue Lehre der Psychoanalyse öffentlich bekundete. Dass er dafür während Jahren wie bestraft wurde und in Not leben musste, mag die Arbeit an „Totem und Tabu“ (1912-13) mitbegründet haben. Auch hier geht er auf die verborgenen Kräfte der Neurose, insbesondere der Zwangsneurose ein, die er mit dem Glauben an die „Allmacht der Gedanken“ [62] resp. mit dem Glauben an die die Kraft der Magie in den frühen, animistischen Weltauffassungen in Verbindung bringt. „Die primären Zwangshandlungen der Neurotiker sind eigentlich durchaus magischer Natur. Sie sind, wenn nicht Zauber, so doch Gegenzauber zur Abwehr der Unheilserwartungen, mit denen die Neurose zu beginnen pflegt. Sooft ich das Geheimnis zu durchdringen vermochte, zeigte es sich, dass diese Unheilserwartung den Tode zum Inhalt hatte. (…) Auch die Schutzformeln der Zwangsneurose finden ihr Gegenstück in den Zauberformeln der Magie.“[63]
Und 1938-39, als Freud sein Moseswerk schrieb und nach dem Auszug aus Wien zu veröffentlichen wagte, war für ihn auch hier „die Allmacht der Gedanken“ der drängende und tragende Impuls? Marthe Robert hat in ihrer sorgfältigen – und ebenfalls wagemutigen – psychoanalytischen Untersuchung Freuds klar diese Meinung vertreten.[64] Während „der Mann der beginnenden Reifezeit, der uns in der ’Traumdeutung’ begegnet, versucht im Traum den gesellschaftlich und intellektuell mediokren jüdischen Vater loszuwerden, der sein eigenes Leben an die unerträgliche Enge einer beschämenden Herkunft kettet, sieht für den Greis, der den ’Moses’ schreibt, die Situation ganz anders aus. Er zählt zu den berühmtesten Männern seiner Zeit und ist auf Rang und Titel nicht mehr angewiesen. Gerade weil er seinen Traum ernst zu nehmen verstand, hat er nach und nach seine kühnsten Ambitionen verwirklichen können. Aber bei der Erfüllung lässt ihn doch das Problem seiner Herkunft nicht los, das stets die eigentliche Antriebskraft seines Forschungsdrangs gewesen ist. Oder genauer gesagt: er kann nicht zur Ruhe kommen, ehe er nicht jene letzte Version gefunden hat, die endlich die Kette der Generationen aufbricht und ihn für immer frei macht von all den Vätern, Verwandten und Verfahren, die ihn die empörende Begrenzung der menschlichen Existenz spüren lassen. Kurz vor der Heimkehr zu seinen Väter oder, wie es in der Sprache der Bibel heisst, in Abrahams Schoss, erlebt Freud noch einmal einen letzten Sturm der Revolte gegen das unentrinnbare Schicksal der Sohnschaft, das jeden Menschen an Herkunft, Rasse und Namen bindet und so mit unübersteigbaren Schranken einengt. (…) Man kann sogar vermuten, dass er die Geschichte Moses und seines Volkes einzig und allein darum schreibt, weil er den furchtbaren Augenblick der Wiederkehr – ’Wiederkehr des Verdrängten’ und Heimkehr in den Schoss Abrahams – , den keine Macht der Welt ihm ersparen kann, noch ein klein wenig hinauszögern will.“
War es zutiefst und vor allem ein letztes, magisches Abwehrverhalten gegen die Unheilerwartungen, ein verzweifeltes und zugleich geniales Kräftemessen mit dem Tod, mit welchem Freud sich in die Nähe zu Moses versetzte? Marthe Robert stimmt dieser Deutung zu: „Um nicht sterben zu müssen, erklärt Freud in diesem Buch, das als sein Testament gelten darf, dass er nicht Salomon (Shlomo), der Sohn Jacobs ist und auch nicht Sigmund, der abtrünnig gewordene Sohn, dem schon sein Name ein grosses Geschick verheisst. Er ist so wenig Jude, wie Moses oder Moshe ein Jude war, auch wenn das jüdische Volk diesem fremdstämmigen Führer seine Existenz verdankt. Und so radikal wie Moses mit seiner ägyptischen Heimat und ihren Machthabern gebrochen hat, die ihn wegen seiner zukunftsweisenden Ideen verfolgten, hat auch Freud innerlich alle Bindungen an Deutschland gekappt, hat er nicht nur mit dem Deutschland der Nazis gebrochen, sondern mit allem, was noch deutsch an ihm war. Und so kann er nun in dem Augenblick, da er abtreten muss von der Bühne, auf der er so kühn seine Rolle gespielt hat, von sich sagen, dass er weder Jude noch Deutscher noch sonst irgend etwas ist, das mit Namen zu nennen wäre: er will nichts sein als der Sohn von Niemand und Nirgendwo, der Sohn einzig und allein seiner Werke und seines Werkes, dessen Identität wie die des ermordeten Propheten über die Jahrhunderte hinweg ein verwirrendes Rätsel bleibt.“[65]
[1] Salvatore Quasimodo (geb. 1901, gest. 1968), Sohn eines Eisenbahners, lernte im Selbststudium Latin und Griechisch, war ein hervorragender Übersetzer grosser Werke aus den alten Sprachen wie aus dem Englischen und Französischen, war 1959 Nobelpreisträger für Literatur. – Das Gedicht “An den Vater” erschien 1958 in “La terra imperaggiabile”; es findet sich in der Sammlung ausgewählter Gedichte von Salvatore Quasimodo (auf Italienisch und ins Deutsche übersetzt von Gianni Selvani) in “Das Leben ist kein Traum”. Piper Verlag, München/Zürich 1987, S. 52-55
[2] René Beer-Hofmann ( geb 11.07.1866 in Rodau/Wien, gest. 26.09.1945 in New York). Schlaflied für Mirjam. In: Jahrhundertgedächtnis. Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Harald Hartung. Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1998, S. 32
[3] Arnold Zweig. Ein kleiner Held, in: Knaben und Männer. S. 63, Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 1931.
[4] geb. 10. 11. 1887 in Polen, gest. 26. 11. 1968 in Ostberlin
[5] Der Untertitel verweist auf den Inhalt: Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargestellt am Antisemitismus. Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam 1927
[6] Arnold Zweig hatte die Kindheit im niederschlesischen Glogau (heute polnisch Glogov) als Sohn einer zugleich emanzipierten und traditionell-jüdischen Handwerkerfamilie erlebt. Sein Vater Arnold Zweig war Sattlermeister, der dem Sohn Gymnasium und Studium in Breslau (polnisch Wroclaw), München, Berlin, Göttingen, Rostock und Tübingen ermöglichte. Früh schon, beinah mit den ersten literarischen Publikationen, kam Arnold Zweig 1915 – er war 28 Jahre alt – öffentliche Beachtung, ja Ehrung[6] zu. Gleichzeitig wurde er als Soldat der Preussischen Armee in den Ersten Weltkrieg eingezogen und machte in den zermürbenden Schlachten in Serbien, in Belgien und im französischen Verdun alle Erfahrungen der Sinnlosigkeit des Kriegs und der Hilflosigkeit des einzelnen Menschen. Er wurde zum überzeugten Pazifisten, war jedoch weiter als Armeeberichterstatter der Kriegsgeschehnisse in Osteuropa eingesetzt. Damit hatte er nächste Kenntnis der desolaten Verluste der Preussischen Armee und der damit einhergehenden Armut der Bevölkerung , lernte jedoch die Bedeutung der zionistischn Bewegung für das von Pogromen heimgesuchte Ostjudentum kennen. Martin Bubers sozialistischer Zionismus überzeugte zunehmend auch ihn. Noch mitten im Krieg heiratete er seine Cousine Beatrice Zweig – Dita -, eine Malerin, die ihm zwei Söhne gebar, Michael (1920) und Adam (1924). Während der Weimarer Republik befasste sich Arnold Zweig in gesellschaftskritischen Romanen mit den Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs, auch mit der Betörbarkeit sowohl der armen Leute wie der bürgerlichen Intellektuellen durch politische Theorien und Utopien. Er stand damit Lion Feuchtwanger nah, der ihn Zeit seines Lebens unterstützte. Nach dem Hitlerputsch von 1923 sah Arnold Zweig sich in München gefährdet, zog mit seiner Familie nach Berlin, publizierte weiter und trat dem P.E.N.-Club bei. Doch als 1933 auch seine Bücher in Deutschland verbrannt wurden, zog er zusammen mit seiner Frau und den zwei Söhnen über die Tschechoslowakei und die Schweiz nach Sanary-sur-Mer in Südfrankreich, wo er Lion Feuchtwanger, Annah Seghers und Bertold Brecht wieder traf, sich jedoch entschloss, nach Haifa ins damalige Palästina zu ziehen. Doch es war ein politisch und kulturell zutiefst belastendes Exil, das ihn bewog, 1948 nach Ost-Berlin zurückzukehren. Er wurde Mitglied des Weltfriedensrates und Abgeordneter der Volkskammer der DDR, wurde vielfach geehrt, erblindete zunehmend und starb mit 81 Jahren, am 26. November 1968. Sein Grab befindet sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.
[7] Sigmund Freud-Arnold Zweig. Briefwechsel. Hrsg. Ernst L. Freud. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1984, S. 157
[8] Hugo von Hofmannsthal, geb. 01.02.1874, brach am 15. Juli 1929 tödlich zusammen, als er sich auf den Weg zum Begräbnis seines ältesten Sohnes machen wollte, der sich zwei Tage vorher selber das Leben genommen hatte.
[9] Arthur Schnitzler, geb. 1862 in Wien, Sohn des Kehlkopfspezialisten Johann Schnitzler, dessen Assistent er wurde, war ab 1885 mit S. Freud sowie ab 1890 mit Hugo von Hofmannstahl in nahem Kontakt.
[10] cf. 18), S. 42
[11] cf. 18), S. 18-21
[12] cf. 18), S. 25-26. Stefan Zweig (geb. 28.11.1881 in Wien, gest. 23 02.1942 durch Selbstmord in Petropolis bei Rio de Janeiro) hatte in einem literarischen Essay Freuds psychoanalytische Entdeckung und Auseinandersetzung mit dem Unbewussten mit Franz Anton Mesmer (1734-1815) und dessen Magnetismus sowie mit der Amerikanerin Mary Eddy Baker (1821-1910), der Gründerin der Christian Science und der damit verbundenen Praxis des “christlichen Heilens”, in Verbindung gebracht. – Stefan Zweig. Die Heilung durch den Geist. Insel Verlag, Leipzig 1931. (Dieses Buch wurde von Stefan Zweig Albert Einstein gewidmet, den er 1928 im Versammlungsraum der Christian Science in Princeton besucht hatte).
[13] Brief vom 4. Mai 1932, cf. 17), S. 50
[14] cf. 17), S. 55
[15]Sigmund Freuds Vater Jacob Freud war mit einundachtzigeinhalb Jahren gestorben.
[16] cf. 18), S. 149
[17] cf. 18), S. 166
[18] cf. 18), S. 178
[19] cf. 17), S. 179
[20] cf. 17), S. 186
[21] cf. 17), S. 188
[22] cf. 17), S. 191
[23] Caliban (Anagramm von canibal), eine fiktive Halbtier-Halbmenschgestalt, tritt in Shakespear’s “Sturm” erst gegen Ende auf, ein bewegende Figur der Konfrontation von wilder Naturhaftigkeit und Unterwerfung unter führungsmächtige Herrscherfiguren. Es gibt im 3. Akt, 2. Szene eine bedeutungsvolle Rede Calibans, die deutlich macht, wie sehr diese Gestalt im Vorfeld des Rationalen lebt (gemäss der Übersetzung von A.W. von Schlegel): “Sei nicht furchtsam, die Insel ist voll von Geräuschen, tönen und anmutigen Melodien, was Freude bringt und nicht schmerzt. Manchmal erklingen tausend klimpernde Instrumente über meinem Haupte – und manchmal hör’ ich Stimmen, die, wenn ich nach langem Schlaf erwachen würde, mich wieder schläfrig machten; dann deucht’s mir im Traume, die Wolken täten sich auf und offenbarten Schätze, bereit, auf mich herab zu regnen, dass ich, wenn ich erwache, schrei’ und weine, weil ich wieder träumen möchte.” (Erste Aufführung von “Tempest” am 1.11.1611 im Schloss Whitehall vor dem König, dann am 20.5. 1613 anlässlich der Hochzeit von Prinzessin Elisabeth, der ältesten Tochter von König Jacob, mit dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz)
[24] Arnold Zweig oder Politik und Leidenschaft. cf. 15), S. 11-12
[25] mit Martha Bernays (1861-1951), Tochter einer angesehenen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie aus Hamburg
[26] Mathilde (1887-1978), Jean Martin (1889-1967). Oliver (1891-1969), Ernst August (1992-1970), Sophie (1893-1920), Anna (1895-1982)
[27] Wilhelm Fliess (geb.1858 in Ahrenswalde, heute Choszczvo, gest. 1928), aus sephardischer Familie, hatte nach Abschluss des Medizinstudiums in Berlin drei Monate im Wiener Allgemeinen Krankenhaus gearbeitet und anlässlich einer Abendgesellschaft bei Josef Breuer Sigmund Freud persönlich kennen gelernt. Er spezialisierte sich auf den Nasen-Halsbereich und brachte diesen in Verbindung mit einer weiblichen und einer männlichen Perioden- und Reflexzonentheorie, vertrat dabei auch die Theorie der Bisexualität und unterstützte Freud bei der Entwicklung der Neurosentheorie. Nach ca. fünf Jahren intensivster Freundschaft entstand eine wachsende Differenz zwischen den beiden, die Freud zutiefst verunsicherte.
[28] Der Briefwechsel Sigmund Freud-Wilhelm Fliess findet sich einerseits in der Gesamtausgabe im Fischer Verlag, Frankfurt a.M., andererseits bei Didier Anzieu. Freud’s Selbstanalyse. Bd. I 1895-1898; Bd. II 1898-1902. Verlag Internationale Psychoanalyse, München-Wien 1990, auf die ich mich hier beziehe. Betr. alles Zitate von Freuds Briefen rund um den Tod seines Vaters cf. Bd.I, S. 75-76 ff.
[29] Sigmund Freud. Die Traumdeutung. S. Fischer-Verlag, Frankfurt a. M. 1972 (Erste Publikation 1899 resp. 1900 im Verlag Franz Deuticke, Leipzig/Wien), S. 315 ff
[30] Freud bezieht sich hier auf seine Forschungsarbeit im Laboratorium von Ernst Brücke (18876 bis 1882), die er mit seinem Doktorat abschloss, ferner auf seine daran anschliessende Arbeit im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, bei welcher die bis 1894 dauernde, dann abgebrochene Freundschaft mit dem 12 Jahre älteren Arzt Josef Breuer und die gemeinsame Erforschung der Zusammenhänge von Hysterie einsetzte (der Fall Anna O. resp. Bertha Pappenheim, mit ihr die Erkenntnis der begrenzten Heilungsmöglichkeit durch Hypnose wie auch jene der Wichtigkeit der„talking cure“) wie von Cerebrallähmungen bei Kindern (verbunden mit gemeinsamen Publikationen), ferner die mit dem Entwurf einer Neuronentheorie verbundene Anstellung als Assistenzarzt in der Abteilung für Psychiatrie (später Abteilung für Nervenkrankheit) von Theodor Meynert, ferner die viereinhalbmonatige Zusammenarbeit (Mitte Oktober 1885 bis Ende Februar 1886) mit dem in seiner diagnostischen und therapeutischen Arbeit bedeutenden Neurologen Jean-Martin Charcot in der Salpêtrière in Paris, dann mit der Praxiseröffnung im April 1886 die persönlichen Untersuchungs- und Behandlungserfahrungen (in nahem Austausch mit Wilhelm Fliess bis 1900, die mit einer leidenschaftlichen Freundschaft einherging, die einer Hörigkeit gleich kam, bis sich Freud bewusst wurde, dass die von ihm mittels Fliess angestrebte „Selbstanalyse“ von diesem nicht mitgetragen wurde ), sowohl der kathartischen Methode wie der Methode der „freien Assoziation“, für welche ab März 1896 die Bezeichnung Psychoanalyse verwendet wurde.
[31] cf. 38), S. 24
[32] cf. 41), S. 315f; cf. auch Briefwechsel Freud-Fliess, Brief vom 2. November 1896, cf. auch 40) Didier Anzieu, Bd. I, S. 76 ff
[33] der letztgeborene Alexander stand dem zehn Jahre älteren erstgeborenen Sjg(is)mund am nächsten; die übrigen Geschwister waren Julius, der mit sechs Monaten starb, Anna, Rosa, Marie, Adolfine und Pauli.
[34] Jacob Freuds zweite Ehefrau Rebecca blieb kinderlos
[35] Sigmund Freud. Briefe 1873-1939 (ausgewählt von Ernst und Lucie Freud), S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1968 / 1980, S. 411 f (Brief an A.A. Roback, 20. 02. 1930)
[36] Für Freuds Mutter eine doppelte Tragik, da während der Schwangerschaft von Julius schon ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Julius, der ihr am nächsten gestanden hatte, wegen Tuberkulose verloren hatte.
[37] Sigmund Freud. Psychopathologie des Alltagslebens (1904), Gesammelte Werke, Bd. IV. S. fischer Verlag, Frankfurt a. M.1970, S. 24
[38] cf. a) Ernest Jones. Sigmund Freud. Life and work. Bd. I: The young Freud 1856-1900. Hogarth Press, London. S. 28f . (In deutscher Übersetzung: Das Leben und Werk Sigmund Freuds. 3 Bände / Bd. I Die Entwicklung zur Persönlichkeit und die grossen Entdeckungen 1856-1900 (Bd. II. Jahre der Reife 1901-1919; Bd. III. Die letzte Phase 1919-1939) – b) Marthe Robert. Die Revolution der Psychoanalyse. Leben und Werk von Sigmund Freud. Übersetzt aus dem Französischen von Elisabeth Wiemers und Elisabeth Mahler. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1967, S. 26f (Erstausgabe: La Révolution psychoanalytique. La vie et l’oeuvre de Sigmund Freud. Editions Payot, 1964)
[39] Sigmund Freud. Der Familienroman der Neurotiker (1908). Studienausgabe Psychologische Schriften. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1970, S. 221-226. (Erstmals erschienen in Otto Rank. Der Mythus von der Geburt des Helden. Verlag Deuticke, Leipzig & Wien 1909; 2.Aufl. 1922, S. 82-86)
[40] Ernest Jones cf. 45)
[41] cf. 41), S. 267
[42] 1924 erfolgte die erste Ausgabe von Freuds Gesammelten Werken
[43] Im September 1926, im Anschluss an Freuds 70. Geburtstag, erfolgte die Gründung der Londoner Klinik sowie die Gründung der „Psychoanalytischen Vereinigung von Paris“ sowie des „Französischen Instituts für Psychoanalyse“.
[44] An den Bürgermeister von Freiberg-Pribor schrieb Freud am 25. 10. 1931: „Ich habe Freiberg im Alter von drei Jahren verlasen, es mit 16 Jahren als Gymnasiast auf Ferien, Gast der Familie Fluss, wieder besucht und seither nicht wieder. Vieles ist seit jener Zeit über mich ergangen (…). Es wird dem nun Fünfundsiebzigjährigen nicht leicht, sich in jene Frühzeit zu versetzen, aus deren reichem Inhalt nur wenige Reste in seine Erinnerung hineinragen, aber des einen darf ich sicher sein: tief in mir, überlagert, lebt noch immer fort das glückliche Freiberger Kind, der erstgeborene Sohn einer jugendlichen Mutter, der aus dieser Luft, aus diesem Boden die ersten unauslöschlichen Eindrücke empfangen hat.“ In: Briefe, cf. 47), S. 425
[45] cf. 47), S. 418
[46] Marthe Robert cf. 50b), S. 342
[47] cf. 18), S. 102
[48] von denen Sophie Halberstadt-Freud, die von ihrem Vater besonders geliebte Zweitjüngste, bei der Geburt des zweiten Sohnes starb.
[49] cf. 47) Brief an Romain Rollan (Beitrag zur Festschrift zu dessen 70. Geburtstag)
[50] Cf. 18), 53
[51] aus einer polynesischen Sprache (vermutlich Tonga) abgeleitet, bedeutet unantastbar, aber auch unverletzlich.
[52] Eine ausführliche analytische und medizinisch-anamnestische Abhandlung über Freuds Gaumen- und Kieferkrebs findet sich bei Jürg Kollbrunner. Der kranke Freud. Verlag Kett-Cotta,, Stuttgart 2001
[53] Eine kaum beachtete Erweiterung von Freuds Untersuchung und Deutung der Moses-Gestalt findet sich im kleinen Werk von Otto Kraus. Moses, der Erfinder der Buchstaben, der Ziffern und der Null. Selbstverlag Otto Kraus, Bederstrasse 123, 8002 Zürich, 1953. Otto Kraus vergleicht Freuds Thesen mit den auch von Freud beigezogenen früheren Moses-Untersuchungen von Eduard Meyer sowie mit jenen von Rudolf Kittel; dabei betont er, dass „Freud das Problem in seinem Umfang am genauesten erfasste“ (S. 12). Für Otto Kraus ist eines der massgeblichen Kriterien, die zu beachten sind, dass Moses ein Stotterer war, wie er durch verschiedene Stellen der „Schrift“ belegt. Die grosse Einsicht in die Ordnungskraft des Göttlichen habe sich durch Moses daher nicht – oder nur ungenügend – aussprechen lassen. Er habe anderer Zeichen bedurft, der Zeichen der Konsonanten, die ihm – gemäss der Geschichte vom brennenden Dornbusch, den das Feuer nicht verzehrte – durch die Figur der Flammen offenbart worden seien und die ihm ermöglicht hätten, die zehn Gebot, die er im Auftrag des unsichtbaren, transzendenten und alleinigen Gottes den Menschen für ihr Verhalten zu diesem Gott und unter einander zu vermitteln hatte, auf den „Tafeln“ schriftlich aufzuzeichnen.
[54] Sigmund Freud. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. III.Teil. Gesammelte Werke, Bd. 9. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 576ff
[55] dessen Bedeutung wurde von Freud ausführlich abgehandelt in: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker (1912-1913). In: Gesammelte Schriften. Bd. 9, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 287-444
[56] Die etymologische Erklärung von Totem: „Totem“ ist abgeleitet aus „ototeman“ und hat gemäss der Sprache des amerikanischen Indianervolkes Algonkin die Bedeutung „sein geschwisterlicher Verwandter“ oder „sein Bruder“ bzw. „seine Schwester“; „ote“ bezeichnet die Verwandtschaft zwischen leiblichen (sowie Adoptiv)geschwistern und wird mit einem vorangesetzten Personalpronomen ( „o“ – „sein“) und einem possessiven Nominalsuffix (-„m“ – „eigen“) und ev. Mit einem Suffix der 3. Person (-„a“ oder „an“) verbunden; das erste „t“ ist eingeschoben, um den Zusammenstoss der beiden „o“ zu vermeiden. Wörtlich bedeutet „o-t-ote-m-a(n)“ also „sein eigener Bruder-Schwester-Verwandter“. – Der Begriff „ote“ bezeichnet aber nicht der den Verwandten innerhalb der Familie, sondern auch ein Tier, das aus irgend einem Grund zum Symbol einer Familie gemacht wurde, dadurch als verwandt gilt und von einer Generation auf die andere „vererbt“ wird. (cf. Etymologisches Wörterbuch. Lexikographisches Institut, München 1982)
[57] Häufig wird Moses in der bildenden Kunst gehörnt dargestellt, cf. Abbildungen 10, 11 und 12 in: Gerda Weiler. Das Matriarchat im Alten Israel. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart/Berlin/Köln 1989, S. 154 ff. – Auch die ägyptischen Gottheiten wurden vor und nach Echnaton und dessen einem Gott, dem Sonnengott Aton, mit Tierhäuptern dargestellt, wie auch in der griechischen Mythologie die Verbindung von Göttergestalten mit Tier und Mensch von zentraler Bedeutung war. – Noch in der frühchristlichen Bilderdarstellung findet sich z.B. je ein Tier in Verbindung mit den vier Aposteln.
[58] „Rabbi“ hat die Bedeutung von „Meister“ in der Deutung der „Schrift“, d.h. von Schriftgelehrtem.
[59] Pnin Navè Levinson. Einführung in die rabbinische Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, S. 1-2
[60] Auf die Bedeutung war Freud schon 1908 eingegangen; cf. 51)
[61] Totem und Tabu (1912-1913). Studienausgabe Bd. 9, S. 324
[62] cf. 69). S. 374
[63] cf. 69), S. 375-376
[64] Marte Robert. Sigmund Freud – zwischen Moses und Ödipus. Die jüdischen Wurzeln der Psychoanalyse. Paul List Verlag KG, München 1975. Aus dem Französischen übersetzt von Hans Krieger. Die Originalausgabe ist: D’Oedipe à Moïse – Freud et la conscience juive. Edition Calmann-Lévy, Paris 1974
[65] cf. 73), S. 158
3. Vorlesung
Der „ liebste Vater” und der furchterregende Vater” – die unlösbare Paradoxie:
Franz Kafka
Franz Kafirn erscheint mir wie das geheimnisvolle Aufleuchten eines verborgenen Sterns in einem Zwischenstück von Sigmund Freuds Leben. Freud kannte Kafka nicht, während Kafka von Freud wusste, auch von der Psychoanalyse. Was in Hinblick auf die Lebensdaten77 leicht verständlich erscheint, widerspiegelt sich rätselhaft in der analogen, jedoch ungleich umgesetzten Versessenheit, das eigene, einsame Menschsein im Zwiespalt des Verborgenen und kaum Benennbaren zu ergründen, um das Menschsein überhaupt in jeder Art von Paradoxie genauer zu durchschauen, bei Freud mit dem Bedürfnis wissenschaftlicher Untersuchung und möglichst untrüglicher Benennung, bei Kafka mit dem Bedürfnis des Überlebens. ,,Psychologie ist Ungeduld” gemäss Kafka, denn „ alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen, ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache. – Der Beobachter der Seele kann in die Seele nicht eindringen, wohl aber gibt es einen Randstrich, an dem er sich mit ihr berührt. Die Erkenntnis dieser Berührung ist, dass auch die Seele von sich selbst nicht weiss. Sie muss also unbekannt bleiben. Das wäre nur dann traurig, wenn es etwas anderes ausser der Seele gäbe, aber es gibt nichts anderes. ” – Der Körper ist nicht ein Sein, er ist das Andere, das schmerzbesetzte und dunkle Gehäuse. Für Kafka ist „ sein Haus tragbar, er lebt immer in seiner Heimat”, zu eng und einzäunend ist jedoch der Körper für Kafka, der – ,, wie ein Eichhörnchen im Käfig” – daraus auszubrechen versucht und nicht kann, ,, hilflos, eine Scheune im Frühjahr, ein Schwindsüchtiger im Frühjahr“ 78. Beim „ Einschlafen am Nachmittag” kommt ihm vor, ,, als hätte ich die feste Schädeldecke, die den schmerzlosen Schädel umfasst, tiefer ins Innere gezogen und einen Teil des Gehirns draussen gelassen im freien Spiel der Lichter und der Muskeln”. Beim Erwachen mag es gelingen, ,,an einem kalten Herbstmorgen mit gelblichem Licht, durch das fast geschlossene Fenster dringen und noch vor den Scheiben, ehe man fällt, schweben, die Arme ausgebreitet, mit gewölbtem Bauch, rückwärtsgewandten Beinen, wie die Figuren auf dem Vorderbug der Schiffe in alter Zeit. “‘79
Die Differenz in der Äusserung des Widersprüchlichen zwischen Freud und Kafka ist grösser als die Nähe, und doch ist die Nähe grösser als die Differenz in den Ursachen, die beide zu Suchenden werden liess: Es ist die unausweichliche Widersprüchlichkeit von Körper und Geist, von Unschuld und Schuld, von Schuld und Strafe, von Belastung und Hoffnung, von Leid und flüchtigem Glück, von nicht gewähltem und gleichzeitig gewähltem Leben, von Hunger nach Leben, doch gleichzeitig nach Schlafen und Sterben -, es ist das so belastete Menschsein mit den Vatermächten und Kampfgeschichten, das in der Traumwelt das Leben am nächsten erlebt, in den Erdabgründen und Dachstockkammern, in den Beamtenlabyrinthen und in den Flugbahnen der Vögel oder in zeitlosen, fast seligen Momenten neben der Wiege eines neu geborenen, schlafenden Kindes und das mittels der Sprache über das Schreiben sich von den Lasten zu befreien versucht, ohne dass es gelingt. Was zwischen Freud und Kafka eine Nähe oder Ähnlichkeit beinhalten kann, beruht auf der nicht einlösbaren und nicht erfüllbaren, schwierigen Tatsache, Teil des assimilierten, zugleich entfliehenden und anhaftenden Judentums zu sein, des gleichzeitigen Nichtseins und Seins, das einherging mit der väterlichen Macht und Schwäche.
Auch über den Rückzug ins nächtliche Schreiben, das ermöglichte, in Briefen, in Tagebuchnotizen, in Erzählungen und Romanen herauskristallisieren zu lassen, was dem eigenen Suchen und Denken entsprach, war Freud und Kafka eine Ähnlichkeit eigen, die jedoch nichts Ähnliches in Hinblick auf die Zielsetzungen vorwies. Während Freud nach der gesellschaftlichen Bestätigung persönlichen Wertes und Ansehens suchte und aus seiner forschenden Befliessenheit eine Lehre aufzubauen begann, scheute Kafirn vor jeder Art von Beachtung zurück und verlangte gar, dass alles, was er in nächtlicher Leidenschaft zu Papier gebraucht hatte, nach seinem Tod vernichtet würde, mit Ausnahme der wenigen Werke, die er selber noch zu Lebzeiten veröffentlicht hatte'”.
Merkwürdig ähnlich und doch ganz anders war bei Freud und bei Kafka die Sehnsucht nach einem männlich-weiblichen Bezugsgeflecht, das sich mit alle den intensiven Gefühlen freundschaftlicher Bewunderung und Offenheit verband, jedoch auch schnell voll angstbesetzter Abwehr und Fremdheit war, wenn diese Gefühle falsch verstanden wurden oder wenn diese mit anderen Erwartungen beantwortet wurden. Die grosse Differenz zwischen den beiden Männern war, dass Freud sich angesichts seiner Möglichkeit, durch persönliche Vaterschaft die als Sohn erlebte Vaterschaft wett zu machen, dass er heiratete und Kinder zeugte, auch dass er bestrebt war, um sich noch einen zusätzlichen „Familienkreis” von ihn bewundernden oder ihn anfeindenden anderen „Söhnen” und „Töchtern” zu schaffen. Kafka dagegen verliebte sich zwar immer wieder, verliebte sich neu, sehnte sich danach und erschrak davor, verlobte sich zweimal – mit Felice Bauer – und plante zu heiraten, doch wirkte er so schnell wie möglich den Plänen entgegen und löste sie wieder auf In einer Ehe leben zu können, das wünschte er, so weit er sich vorstellen konnte, dabei an der Wärme zu sein; doch wenn er sich vorstelle, die Rolle des Herrn, Herrschers und Vaters dabei einzunehmen, die er als liebendes Kind wie eine Maus oder als dankbarer Untergebener wie ein Hund erlebt hatte, fühlte er sich angewidert und unfähig. Weder die eine noch die andere Lösung konnte genügen.
Solange Kafka noch Kräfte in sich spürte, ging es in diesem inneren Paradox um einen Kampf, der sich nach seinem Ermessen immer wieder auf die negative Seite hin, auf die schuldbeladene Verliererseite hin entschied. So schrieb er an Felice Bauer, als er spürte, dass sie durch ihn und sein Versagen im Pläneschmieden und in der Lebenssicherheit mehr und mehr enttäuscht und traurig war. ,,Dass zwei in mir kämpfen, weißt Du. Dass der bessere der zwei Dir gehört, daran zweifle ich gerade in den letzten Tagen am wenigsten. Über den Verlauf des Kampfes bist Du ja durch fünfJahre durch Wort und Schweigen und durch ihre Mischungen unterrichtet worden, meistens zu Deiner Qual. Fragst Du mich, ob es immer wahrhaftig war, kann ich nur sagen, dass ich keinem Menschen gegenüber bewusste Lügen so stark zurückgehalten habe, oder, um noch genauer zu sein, stärker zurückgehalten habe als gegenüber Dir. Verschleierungen gab es manche, Lügen sehr wenig, vorausgesetzt, dass es über ‘,.sehr wenig; Lügen geben kann. Ich bin ein sehr lügnerischer Mensch, ich kann das Gleichgewicht nicht anders halten, mein Kahn ist sehr brüchig. Wenn ich mich auf mein Endziel hin prüfe, so ergibt sich, dass ich nicht eigentlich danach strebe, ein guter Mensch zu werden und einem höchsten Gericht zu entsprechen, sondern, sehr gegensätzlich, die ganze Menschen- und Tiergesellschaft zu überblicken, ihre grundlegenden Vorlieben, Wünsche, sittlichen !deale zu erkennen, sie auf einfach Vorschriften zurück zuführen und mich in dieser Richtung möglichst bald dahin zu entwickeln, dass ich durchaus allen wohlgefällig würde, und zwar (hier kommt der Sprung) so wohlgefällig, dass, ohne die allgemeine Liebe zu verlieren, als der einzige Sünder, der nicht gebraten wird, die mir innewohnenden Gemeinheiten offen, vor aller Augen, ausführen dürfte. Zusammengefasst kommt es mir also nur auf das Menschengericht an und dieses will ich überdies betrügen, allerdings ohne Betrug. 81
Am 23. September 1912, kurz nach Beginn seiner Beziehung zu Felice Bauer, die er bei seinem Freund Max Brod kennengelernt hatte und die ihm aufgefallen war, weil er nichts Auffälliges an ihr feststellen konnte, wie er im Tagebucheintrag vom 20. August 1912 festhielt, hatte er in einer Nacht „Das Urteil” geschrieben, ,,von zehn Uhr abends bis sechs Uhr früh in einem Zug”, wie er im Tagebuch festhielt, ,,die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehn. Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärtskam. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gesagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein grosses Feuer bereitet ist, in dem sie vergehn und auferstehn. Wie es vor dem Fenster blau wurde. “82 Kafka erlebte dabei ein Gefühl von Glück, das er selber kaum fassen konnte. Unter dem Namen Georg Bendemann hatte er die Geschichte eines jungen Kaufmanns festgehalten, der nach dem Tod der Mutter allein mit dem altersschwachen, aber, wie sich im Lauf der Erzählung herausstellte, noch übermächtigen Vater lebte und der sich einen Monat zuvor mit „ einem Mädchen aus wohlhabender Familie, Frieda Brandenfeld” verlobt hatte. Diese Verlobung hatte Bendemann nach grossem Zögern seinem Freund in einem Brief mitgeteilt, und mit diesem Brief wollte er an den Vater gelangen. Was daraus folgte, wie seine anfängliche Freude und Zufriedenheit durch die Täuschung in der Einschätzung des Vaters, durch dessen Verurteilung von Braut und Verlobung zum Todesurteil über Georg Bendemann wurde, ,,zum Tod durch Ertrinken”, das diesen in den Tod jagte, diesen letzten Kampf eines mächtigen Vaters mit dem Sohn, von dem er sich entthront fühlte und der diesem das Leben mit einer jungen Frau nicht zugestand, war für Kafka die literarische Übertragung resp. Entladung seiner eigenen Wünsche und Ängste. Er hielt im Tagebuch fest, dass er noch am frühen Morgen den Schwestern mit Erleichterung vorlas, was er geschrieben hatte, auch dass er auch so schnell wie möglich eine Abschrift an Felice Bauer schickte, der er die „Erzählung” gewidmet hatte.
Doch 1917, nachdem auch die zweite Verlobung mit ihr nicht glücken konnte, da ihm keine Einheitlichkeit und mithin keine Art Ehe umsetzbar erschien – nicht mit sich selber und nicht mit Felice -, erklärte er seine Braut zur Richterin. ,,Du bist mein Menschengericht. Diese zwei, die in mir kämpfen, oder richtiger, aus deren Kampf ich bis auf einen kleinen gemarterten Rest bestehe, sind ein Guter und ein Böser; zeitweilig wechseln sie diese Masken, das verwirrt den verwirrten Kampf noch mehr: schliesslich aber konnte ich, bei Rückschlägen bis in die jüngste leit doch glauben, dass es zu dem Unwahrscheinlichsten (das Wahrscheinlichste wäre: ewiger Kampf), das dem letzten Gefühl doch immer als etwas Strahlendes erschien, kommen werde und ich, kläglich, elend geworden durch die Jahre, endlich Dich haben darf. “Am Ende dieses Briefs, der einer der letzten ist, die Kafka an Felice schrieb, heisst es: ,,Im übrigen sage ich Dir ein Geheimnis, an das ich augenblicklich selbst gar nicht glaube (trotzdem mich dies bei Arbeitsversuchen und beim Denken ringsum mich in der Feme fallende Dunkel vielleicht überzeugen könnte), das aber doch wahr sein muss: ich werde nicht mehr gesund werden. Eben weil es keine Tuberkulose ist, die man in den Liegestuhl legt und gesund pflegt, sondern eine Waffe, deren äusserste Notwendigkeit bleibt, solange ich am Leben bleibe. Und beide können nicht am Leben bleiben. “83
Jede Beziehung Kafkas hatte etwas Traumhaftes, Verbotenes und nicht Realisierbares, bedeutete für ihn ein „glücklich sein im Unglück”, resp. ,,im Unglück glücklich sein“. So war für ihn die unausweichliche Realität der nicht lösbaren Folge seiner Herkunft aus der Kain- Geschichte, wie er die Diskrepanz von Gut und Böse, von Schuld und Schuldlosigkeit deutete, als den Spruch, der Kain als Zeichen aufgedrückt worden sei: ,,Es bedeutet den Verlust des Gleichschritts mit der Welt, es bedeutet, dass der, welcher das Zeichen trägt, die Welt zerschlagen hat und, unfähig sie wieder lebend aufzurichten, durch ihre Trümmer gejagt wird; Unglücklich ist er allerdings nicht, denn Unglück ist eine Angelegenheit des Lebens, und dieses hat er beseitigt, aber er sieht es mit überhellen Augen, was in dieser Sphäre etwas ähnliches wie Unglück bedeutet. “84
Dass Kafka sich während fünf Jahren an Felice Bauer geklammert hatte, weil er einer selber gewählten Klammer bedurfte, in der Hoffnung, so die Klammer der väterlichen Macht zu lösen, dass er diese aber nicht lösen konnte, war für ihn Betrug und Versagen, eine nicht lösbare Schuld, die allerdings nicht mit Absicht einherging, sondern auf seiner Unschuld beruhte. Felice hatte er nicht sagen können, was seine Pläne waren. Was ging mit Verlobung – einher?, – dann also Heirat? – doch wann? Kafka war nicht in der Lage, realisierbare Pläne zu haben, Lebenspläne-Zeugungspläne, die letztlich der Fortsetzung des väterlichen Erbes entsprechen würden. Einerseits wünschte er die Nähe zu einer Frau, die ihn liebte, andererseits waren Angst und Widerwillen davor zu gross.
Das wiederholte sich ein knappes Jahr nach der definitiven Auflösung der zweiten Verlobung mit Felice Bauer im Dezember 1917 85 durch die 1919 eingegangene Verlobung mit der damals 28-jährigen Julie Wohryzek86, die Kafika während des von Ottla, seiner ihm nächsten Schwester, organisierten Kuraufenthalts in Schelesen (in der Nähe von Liboch an der Elbe, nördlich von Prag) kennen gelernt hatte, der Tochter eines armen Flickschusters und Synagogendieners aus Prag, die selber einen kleinen Modesalon hatte und die von Fröhlichkeit und Lebensfreude, von Witz und absonderlichen Geschichten erfüllt war. Sie brachte Kafka ständig zum Lachen. In einem Brief an Max Brod hielt er fest, dass er in wenigen Wochen habe aufholen können, was ihm an Lachen während Jahren gefehlt habe. Nachdem er in Schelesen von den alten Ängsten heimgesucht wurde und Julie Wohryzek nach Möglichkeit auszuweichen versuchte, erlebte er, dass sie einander in Prag „ wie gejagt” einander entgegen flogen. Er stellte sich vor, dass mit ihr eine Ehe möglich sein könnte, auch fühlte er sich körperlich ein wenig stärker, obwohl sein Gesundheitszustand nach der Spanischen Grippe, an welcher er 1918 zusätzlich erkrankt war, eher geschwächter zu sein schien. Er bahnte mit Julie zusammen den Plan an, eine gemeinsame Wohnung zu mieten und im November 1919 zu heiraten. Mit diesem Plan einher ging auch der Wunsch, den Widerstand gegen den Vater zu verstärken, für den die gesellschaftliche Herkunft Julies als zu niedrig galt. Doch als kurz vor der Trauung der Mietvertrag nicht zustande kam, deutete Kafka dies als Warnung, dass die Ehe ohnehin zum Scheitern verurteilt sei – und er löste die Verlobung auf
Es war für Kafirn der dritte missratene Heiratsversuch, und verzweifelt rang er in sich selber um Rechtfertigung, um Erklärung seines Versagens, in welchem er sich zugleich als Opfer wie als Täter sah87. Nochmals fuhr er für eine kurze Erholungszeit nach Schelesen in die kleine Pension, in welcher er sich wohl gefühlt hatte, um dort, an diesem Ort des Rückzugs nach einem vulkanartigen Ausbruch seiner Einsamkeit, den „Brief an den Vater” zu schreiben, der wie ein psychischer Bluterguss erscheint. Nie bekam Hermann Kafka88 zu lesen, womit sein Sohn ihn der Schuld für alle quälenden Erfahrungen der Angst und der Wertlosigkeit, für jede Art von Ausgrenzung und Versagen anklagte: für den mangelnden Lebenswert, für die mangelnde Entscheidungssicherheit, für die Angst vor körperliche Nähe, für das Ohnmachtsgefühl gegenüber dem Leiden der Mutter, der Schwestern sowie der Angestellten, für den mangelnden Halt im Judentum – für alles, was er als Sohn seit der frühen Kindheit und Jugend bis in den unmittelbaren Moment an väterlicher Übermacht, an Launen und Willkür erlebt hatte.
Die Klammer um Kafka, die bedingungslos und unlösbar war, bestand im Unglück, als Sohn geboren zu sein und als Sohn der väterlichen Linie in der Geschlechtlichkeit wie im Namen nicht entrinnen zu können. Er war so, wie er hiess – ,,Kafka”, tschechisch „cafka” (,,Dohle”) -, ein schwarzer Vogel, der sein Gefieder immer wieder zu heben versuchte, der jedoch die schwarze Farbe, die ihn im Vergleich mit anderen Vögeln als den Wertlosen zugehörig machte, nicht lösen konnte. Dass er fähig war, eine andere Art von Väterlichkeit gegenüber den Kindern seiner Schwestern oder gegenüber Minze Eisner, die während seines zweiten Aufenthalts in Schelesen ebenfalls in der Pension „Stüdl” lebte und sich in ihrer Trauer um den verstorbenen Vater und in ihrer Hilflosigkeit, sich orientieren zu können, sehr an Kafka klammerte, der sie einfach erzählen liess – ,, alle Hysterie einer unglücklichen Jugend”, wie er Ottla schrieb -, und der ihr riet, sich in einer Handelsgärtnerei selbständig zu machen, diese Tatsachen waren für ihn beruhigend, doch erachtete er sie nicht als Leistung.
Die väterliche Klammer, die Kafka nach der Trennung von Julie Wohrysek um sich spürte, war noch härter als jede andere, da er nicht nur die missbilligenden Bemerkungen des Vaters gegenüber Julie in Erinnerung behielt und ihm schien, als hätte er sich wieder dem Vater gefügt. Zusätzlich belastete ihn, dass er sich als männlicher Nachkomme nicht in der Lage fühlte, den ältesten Verpflichtungen – jenen gegenüber dem Judentum” – gerecht zu werden. Gehörte zu diesen Verpflichtungen nicht auch zu heiraten und Kinder zu zeugen? Wieder war es das erstickende Paradox, aus welchem er keinen Ausweg finden konnte: Durch die Assimilationsbestrebungen des Vaters konnte er im Judentum keinen Halt noch Inhalt mehr finden. Trotzdem blieb er unlösbar dem abwesenden und strafenden Gottvater angeheftet; auch „enterbt” wusste er um die verlorene Tradition, die dadurch zum Gebot wurde. ,, Da ich keines Dinges sicher war, von jedem Augenblick eine neue Bestätigung meines Daseins brauchte ... in Wahrheit ein enterbter Sohn.” Als grössten Versager empfand er sich, da er das väterliche Erbe weder in der einen noch in der anderen Richtung korrigieren konnte. Er blieb dem „Westjudentum” zugehörig, das er als trostlose Leere empfand und das er trotz seiner Sehnsucht, der Leere zu entkommen, nicht verlassen konnte – auch nicht durch die Liebe zu Felice Bauer oder zu Julie Wohrysek, die er nicht zu realisieren vermochte; nicht durch seine Ergriffenheit vor dem verachteten Ostjudentum, dem er nicht zugehörte und dem er fremd blieb; und schon gar nicht durch seine Annäherung an den Zionismus, dessen Forderungen er nicht entsprechen konnte. Die Leere hatte sich seiner Seele bemächtigt, es gab in ihr nichts Lebensstärkendes, keine Nahrung und keine Wärme; weder Hunger noch Durst konnten gestillt werden. Was Kafirn durch die Tuberkulose, die nicht mehr heilbar war, als beide Lungen davon betroffen waren und als die Krankheit sich zur Kehlkopftuberkulose verschlimmerte, als Krankheit zum Tod erlebte, hatte sich in psychischer Hinsicht während des Heranwachsens durch alles, was ihn am guten Atmen hinderte, was er weder schlucken noch laut aussprechen konnte, auf zunehmende Weise angekündigt.
Kafkas Sehnsucht, einer anderen Gemeinschaft anzugehören, ohne dabei im Widerspruch zu seiner väterlichen Herkunft zu stehen oder doch nur so weit, dass nicht zusätzliche Schuld daraus wachsen würde, hatte ihn schon während der Gymnasialzeit bewegt, sich von den sozialistischen Ideen angesprochen zu fühlen, die er als eine echte Alternative empfand. Einer Partei beizutreten hätte ihn jedoch wieder in andere Klammer hineingeführt, die er als neue Beeinträchtigung seiner Lebenskraft empfunden hätte. Die Arbeiter standen in seinem Empfinden in einer ähnlichen unlösbaren Abhängigkeit von der Macht und Willkür der Arbeitgeber wie die Söhne von jenen der Väter. Das hatte Kafka schon gespürt, als er nach Abschluss seines Jura-Studiums samt Doktorat in der „Assecurazioni Generali” in Prag gearbeitet hatte und später – bis zur frühzeitigen Pensionierung 1922 – in der „Arbeiter Unfallversicherungsanstalt” in Prag. Auch in dieser Hinsicht ergab sich eine Nichtübereinstimmung von Wissen und Handeln resp. von Tun und von Erfolg, auch hier empfand er sich selber als ungenügend, obwohl seine Arbeit wegen seiner „vorzüglichen Konzeptkraft” als „Versicherungsschriftsteller” Anerkennung bekam, obwohl er vom „Konzipisten” (1910) zum „Vizesekretär” (1913), zum „Sekretär” (1920) und schliesslich zum „Obersekretär” (1922) aufrückte, wobei er auf Grund seiner schweren Krankheit, die während Monaten Kuraufenthalte forderte, nicht arbeiten konnte und im selben Jahr, als er zum „Obersekretär” avancierte, pensioniert wurde'”. Für Kafka hatte gegolten, die Missstände, denen Arbeiter ausgesetzt waren, sowohl in der Industrie wie in allen anderen Bereichen – wie auch im Galanteriegeschäft seines Vaters-, zu Gunsten der Arbeiter und Arbeiterinnen zu erforschen und anzuklagen, gleichzeitig dabei zu wissen, dass er sie nicht beheben konnte. Die einzige Klammer, die immer wieder lösbar war und in welche er hineinkriechen konnte, war das Schreiben, war die Literatur.
Es war im Herbst 1919, als die Beziehung zu Julie Wohrysek noch Bestand hatte, jedoch für Kafka schon in Frage stand, zumal die Heirat infolge des nicht zustande gekommenen Mietvertrags als ausgeschlossen galt, jedoch ohne dass Julie ihm untreu geworden wäre, dass er im Literatencafe „Arco” in Prag Milena Jesenska91 und deren Mann Ernst Pollak, den um zehn Jahre älteren Auslandkorrespondenten einer Prager Bank in Wien, kennen lernte. An jenem Abend bot ihm Milena an, seine „Erzählungen” ins Tschechische zu übersetzen. Kafka fühlte sich durch dieses Angebot überrascht und betroffen, er mochte sich nicht voreilig daran halten. Es war während des Kuraufenthalts in Meran, mit welchem er nach monatelangem Zögern Anfang April 1920 begann und wo Jelena Jesenska ihn besuchen kam, dass ein Briefwechsel von wachsenden Erwartungen, von wechselseitigem Interesse und Verstehen, von heftiger, nicht erfüllbarer Liebe – von Seiten Kafkas was die körperliche Liebe betraf – und gleichzeitigen Enttäuschungen, Vorwürfen und Klarstellungen einsetzte, mit immer neuen Briefen, Reisen und Besuchen, begleitet vom sprachlichen Erarbeiten der Übersetzung einzelner Worte aus dem Deutschen ins Tschechische, von ersten tschechischen Veröffentlichungen von Kafkas „Bericht für eine Akademie” sowie von sechs Texten aus „Betrachtung” in der Zeitschrift „Kmen”, von neuen Verunsicherungen, Selbstanklagen Kafkas, einem ersten Abschiedsbriefe von einander nach Verschlechterung von Kafkas Gesundheitszustand und dem Beginn seines Kuraufenthalts in der Tatra im Dezember 1920- Januar 1921, darauf das verzweifelte Drängen Milenas nach Beibehalten der Beziehung unter Einbezug von Max Brod und anderer Freunde Kafkas, wiederholte Besuche Milenas in Prag in Kafkas Elternhaus nach seiner Rückkehr aus der Tatra, eine zunehmende Verschlechterung von Kafkas Befinden, ein Erholungsaufenthalt bei Ottla in Plana (an der Luschnitz), ein Nervenzusammenbruch im Januar 1922, Erholungsaufenthalt in einer Klinik im Riesengebirge und Rückkehr nach Prag, wo Kafka am „SchlossrRoman arbeitete, den er nicht abschliessen konnte, und gleichzeitig an der Erzählung „Der Hungerkünstler”, an dieser Erzählung, in welcher er seinen eigenen, nie stillbaren Hunger nach der richtigen Nahrung schildert, nach einem Leben ohne qualvolle Paradoxien, nach einem Leben in Einklang mit sich selber, seinen Hunger, der unerfüllt blieb und zum Tode führte. Vermutlich kam es im Juni 1923 zur letzten Begegnung zwischen Milena und Kafka, der kaum mehr zu sprechen imstande war.
Schon im März 1922 hatte Kafka, durch das vom ihm selber geforderte, aufwühlende Nichtgenügen des Briefeschreibens erschöpft, Milena geschrieben, ,, wie kann ich glauben, dass Du die Briefe jetzt brauchst, wo Du nichts anderes brauchst als Ruhe, wie Du es halb unbewusst oft sagtest. Und diese Briefe sind doch nur Qual, unheilbarer, machen nur Qual, unheilbare, was soll das– und es steigert sich(. . .). Still sein ist das einzige Mittel zu leben, hier und dort. Mit Trauer, gut, was tut das? Das macht den Schlaf kindlicher und tiefer. Aber Qual, das heisst einen Pflug durch den Schlaf – und durch den Tag – führen, das ist nicht zu ertragen. “92 Milena Jesenska hielt in einem ihre bedeutenden Texte am 18. 01. 1923 fest, was sowohl Kafka wie sie gewünscht hatten, jedoch einander nicht erfüllen konnten: ,,Das grösste Versprechen, das der Mann der Frau und die Frau dem Mann machen kann, ist jener tiefe Satz, den man Kindern lächelnd zu sagen pflegt: Ich geb dich nicht her. Ist das nicht mehr als ,Ich werde dich lieben bis in den Tod’ und als ,Ich bleibe dir treu bis in den Tod’? Ich geb dich nicht her. Darin liegt alles. (. .. ) Es gibt zwei Möglichkeiten des Lebens: entweder sein Schicksal auf sich zu nehmen, sich zu entscheiden und einzurichten, es zu erkennen und sich an die Vor- und Nachteile zu binden, an das Glück und an das Unglück, tapfer, ehrlich, ohne Feilschen, grossmütig und demütig. Oder sein Schicksal zu suchen: aber durch das Suchen verliert man nicht nur Kraft, Zeit, Illusionen, richtige und gute Blindheit, Instinkt, durch das Suchen verliert man auch den eigenen Wert. Man wird immer ärmer; was kommt ist schlimmer als das, was war. – Und dann: zum Suchen ist Glauben nötig, und zum Glauben vielleicht mehr Kraft als zum Leben. “93
Als Kafka Anfang Juli 1923 in Müritz an der Ostsee weilte, wohin er mit seiner Schwester Elli und deren Kindern für einen Ferienaufenthalt gezogen war, lernte er Dora Diamant (Dymant) kennen. Weder das gemeinsame Interesse an Literatur verband die zwei Menschen noch Heiratswünsche noch irgendwelche andere Erwartungen. Mit Dora Dymant, die viel jünger war wie Kafirn, einer warmherzigen und mütterlichen, gleichzeitig zarten und mutigen jungen Frau, die sich in der elterlichen Familie in Polen nicht wohl fühlen konnte, die daraus ausgebrochen war, die Kafirn liebte, indem sie nichts hinterfragte, sondern für alles, was ihn betraf, ein Zuhören und Verstehen vermittelte, mit ihr lebte er noch einige Monate in Berlin, bis er die letzte Klinik aufsuchte, jene von Kirling hinter Klosterneuburg, nicht weit weg von Wien, und dort von guten Ärzten, jedoch insbesondere von Dora Dymant sowie von seinem ärztlichen, ebenfalls viel jüngeren Freund Robert Klopstock, den er aus dem früheren Klinikaufenthalt in Matliary in der Tatra kannte und den Dora Dymant von seinem Zustand avisiert hatte, in den Tod begleitet wurde.
Auf den Körper, insbesondere auf die Kehle, d.h. auf den Ort, durch welchen Ernährung und Sprache nach Innen und nach Aussen geschehen, hatte sich das psychische Leiden Kafkas aufs schmerzhafteste projiziert, das ihn seit seiner Jugend in stetem Zweifel an seinem Lebensrecht beherrscht hatte und das er in den zum Tod hin gedrängten Gestalten seiner Romane und Erzählungen, ob sie mit vollen Namen oder in Tiergestalt oder einfach als K. in nicht lösbarer Wehrlosigkeit erscheinen, immer wieder aus sich zu lösen versuchte. Dass sich auch für Freud im Bereich von Mundhöhle und Rachen die tödliche Krankheit angesiedelt hatte, in diagnostischer Hinsicht anders, jedoch in Zusammenhang des letzen, kaum mehr tragbaren Leidens sehr ähnlich, hat etwas Bewegendes”, das die Differenz zwischen den beiden, an sich selber und an der väterlichen Erbschaft leidenden Menschen im Sterben sich verflüchtigt, ja aufhebt.
Es war ein leidvolles Sterben für Franz Kafka, nicht ein „ zufriedenes “. wie er Max Brod gegenüber als Wunsch geäussert hatte. Kafka bat Dora Dymant, ihm die Hand auf die Stirn zu legen, damit er Mut bekomme, später Robert Klopstock, ihm mehr Pantopon zu geben, um die Schmerzen zu lindern. ,,Jetzt nicht mehr quälen, wozu verlängern”, und als Klopstock ein paar Schritte sich vom Bett entfernte, um die Spritze zu reinigen, bat er ihn, nicht wegzugehen. Der Freund beruhigte ihn und sagte, er bleibe bei ihm. ,,Aber ich gehe fort“, sagte Kafka leise und schloss die Augen. Es war am 3. Juni 1924, als er starb, durch Herzlähmung, wie es im Sterbebericht hiess. In diesem Moment schlug am düstern Wolkenhimmel, der ab und zu von einem Sonnenstrahl durchbrochen wurde, ein Regenbogen seine Brücke.95
Am 11. Juni 1924 wurde Franz Kafka im Neuen jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz beigesetzt, im selben Grab später auch sein Vater und seine Mutter, deren Namen zur Bestätigung seiner Herkunft sich auf Hebräisch schon in seiner Grabeinschrift finden, denn „der prachtvolle, unvermählte Mann, unser Lehrer und Meister Anschel, seligen Angedenkens, ist der Sohn des hochverehrten R. Henoch Kafka, sein Licht möge leuchten. Der Name seiner Mutter ist Jettl. Seine Seele möge eingebunden sein im Bund des Lebens”. So war Franz Kafka für die Nachwelt nie jemand anderer gewesen und geblieben als der Sohn seiner Eltern. .
Als ich im November 1988 den Neuen jüdischen Friedhof besuchte, der weder vom Nationalsozialismus noch vom Stalinismus zerstört worden war, erschien mir Kafkas Grab unter dem goldenen Laub der grossen und niedern Bäume, die geordnete Alleen und einen wild wuchernden Gartenwald bilden, warm zugedeckt. –
77 Franz Kafirn, geb. 3. Juli 1883 in Prag und gest. 3. Juni 1924 in Kierling bei Klosterneuburg/Österreich (Sigmund Freud, geb. 6. Mai 1856 und gest. 2-3. September 1939, war somit 27 Jahre als, als Kafirn zur Welt kam und 68 Jahre als, als Kafirn starb).
78 Franz Kafirn. Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Die acht Oktavhefte. (Zitate aus den Oktavheften)
79 Tagebücher. November 1911. S. Fischer-Verlag 1973, S. 101
80 Betrachtung, Leipzig 1913. – Die Verwandlung, Leipzig 1915. – Das Urteil. Eine Geschichte, Leipzig 1916. – In der Strafkolonie, Leipzig 1919. -Ein Landarzt. Kleien Erzählungen, München/Leipzig 1919. -Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten, Berlin 1924.
81 Cf. Franz Kafka. Briefe anFelice (von 20. 9. 1912 bis 16. 10. 1917), Fischer Taschenbuch 1976, S. 755 (Brief vom 30. 09. oder 1. 10. 1917, einer der letzten, bevor Kafka sich definitiv von Felice Bauer trennte). – Felice Bauer heiratete 1919, eineinhalb Jahre nach der endgültigen Trennung von Kafka, einen Berliner Geschäftsmann, hatte zwei Kinder (von deren Geburt Kafka noch wusste), konnte 1931 in die Schweiz und 1936 in die USA übersiedeln, wo sie am 15. 10. 1960 starb.
82 Franz Kafka. Tagebücher 1910 – 1923. S. Fischer Verlag 1973, S. 183
83 Brief von Kafirn an Felice, geschrieben in Zürau, wo Kafirn sich bei Ottla erholte, vom 30. September oder 1. Oktober 1917. – In diesem Zusammenhang von Elias Canetti ,. Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice. Edition Akzente. Hanser Verlag, München/Wien 1984.
84 Brief an Felice vom 16. 10. 1917, nachdem Felice Kafka „vergeblich“ in Zürau besucht hatte.
85 Im Juli 1917 hatte sich die zweite Verlobung mit Felice Bauer vollzogen und im August 1917 hatte Kafka den Blutsturz erlebt, der die Tuberkulose-Diagnose bewirkte.
86 Julie war auch der Vorname von Kafkas Mutter, Julie Löwy (geb. 1856, gest. 1934), die aus einer gebildeten und wohlhabenden Familie aus Podiebrad stammte. Im Geschäft ihres Mannes Hermann Kafka, in welchem sie täglich bis gegen 12 Stunden arbeitete, hatte sie das Mitspracherecht.
87 In einem der ersten Briefe an Milena Jesenska schilderte diese doppelte Erfahrung: ,,Sie fragen nach meiner Verlobung. Ich war zweimal (wenn man will, dreimal, nämlich zweimal mit dem gleichen Mädchen) verlobt, also dreimal nur durch paar Tage von der Ehe getrennt. ( … ) Im ganzen habe ich hier und anderswo gefunden, dass die Männer vielleicht mehr leiden oder wenn man es so ansehen will, hier weniger Widerstandskraft haben, dass aber die Frauen immer ohne Schuld leiden und zwar nicht so, dass sie etwa ,nicht dafür können’, sondern im eigentlichen Sinn, der dafür wieder in das ,nicht dafür können’ mündet. Im Übrigen ist das Nachdenken über diese Dinge unnütz. Es ist so, wie wenn man sich anstrengen wollte, einen einzigen Kessel in der Hölle zu zerschlagen, erstens gelingt es nicht und zweitens, wenn es gelingt, verbrennt man zwar in der glühenden masse, die herausfliesst, aber die Hölle bleibt in ihrer ganzen Herrlichkeit bestehen. Mann muss es anders anfangen.” (Franz Kafka. Briefe an Milena. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1983, S. 10)
88 Hermann Kafirn, geb. 1852 im dörflichen Wosek in Südbölunen, gest. 1931 in Prag, hatte sich aus ärmlichsten Verhältnissen, unter denen er schon als Kind in den Dörfern des Umkreises Waren verkaufen musste, zu einem in Prag angesehenen Galanteriewarenhändler hochgearbeitet.
89 Während Freud in Hinblick auf das Judentum zwar Mitglied der Wiener Loge B’nai B’rith89 war, in welcher er auch Vorträge hielt und nach Möglichkeit seinen finanziellen Beitrag leistete, sonst aber alles, was er als “jüdisch” empfand – ausser den Witz und das stete Lernen – als Belastung empfand, bis zur letzten Dringlichkeit der befreienden Loslösung von „Vater Moses” vor seinem Tod, findet sich bei Kafka eine ähnliche Ablehnung alles traditionell Westjüdischen, insbesondere der gesellschaftlichen Anpassung und des Reichtums, das beides durch seinen Vater personifiziert wurde, auch während Jahren des aus dem Westjudentum herausgewachsenen Zionismus, den Max Brod für Kafka repräsentierte. Doch bei Kafka, der seit der Gymnasialzeit eine sozialistisch-politische Linie vertrat, ohne Mitglied einer Partei zu werden, wuchs allmählich eine Liebe zu den aus Russland und Polen verjagten, nach Prag geflohenen „Ostjuden” auf, ja übenahm bald eimnal – im Sinn einer seelischen Verwandtschaft – einen Teil der chassidisch-ostjüdischen, gleichnishaften Erzählweise in sein Schreiben auf. Diese Nähe war durch die jüdische Theatergruppe in Prag – insbesondere durch Isaak Löwy – geschehen. Löwy, den Kafkas Vater mit Abscheu kommentierte „Wer sich mit Hunden zu Bett legt, steht mit Wanzen auf’ (cf. Tagebücher, Anfang November 1911. a.a.O., S. 88, war für Kafka in diesen Jahren – 1911-1912 – sein naher, viel bewunderter Freund.
90 Den genauesten Bericht über die Korrespondenz mit der Firma ergibt sich aus den Briefen an Ottla. – Auch die Studie über Franz Kafka, den Künstler, von Jürg Amann (Verlag R. Piper & Co., München/Zürich 1983) ist aufschlussreich.
91 Milena Jesenska, geb. 10. 08. 1896 in Prag, Tochter des angesehenen Kieferorthopäden Jan Jesenky, gest. 17.5. 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück, wohin sie als nicht-jüdische Polin deportiert worden war, eine mutige Journalistin, deren Begegnung mit Kafka für beide von nicht vergleichbarer Bedeutung war, erfüllbar über die Sprache – die Literatur -, jedoch nicht erfüllbar in der ganzen Bedeutung von Liebe.
92 cf. 87), S. 301
93 cf. 87), S. 400-401 erstmals erschienen in Narodni listy, 63. Jg., Nr. 16, S. 1-2
94 Bei Freud infolge des 1922 aufgetretenen und 1923 erstmals operierten Gaumenkrebs, bei Kafka infolge der 1917 sich durch einen Blutsturz manifestierenden Lungentuberkulose, die sich 1918 nach Spanischer Grippe und Lungenentzündung verschlimmerte und sich in Kehlkopftuberkulose ausweitete.
95 Rotraut Hackennüller. Das Leben, das mich stört. Eine Dokumentation zu Kafkas letzten Jahren 1917-1924. Medusa-Verlag, Wien/Berlin 1984, S. 266.
4. Vorlesung
„Es war ‘Das Mitgebrachte’, das ich immer im eingerollten Innern in der Hand hielt und das mich derart in die Tiefe zog”:
Walter Benjamin
Als Walter Benjamin zu Franz Kafkas zehntem Todestag im Mai und Juni 1934 sich daran setzte, die vielschichtigen Kammern im Werk des Verstorbenen zu durchleuchten, begann er mit der Geschichte um Potemkin”, die ihm erschien „ wie ein Herold, der dem Werk Kafkas zweihundert Jahre vorausstürmt. Die Rätseljrage, die sich in ihr wölkt, ist Kafkas. Die Welt der Kanzleien und Registraturen, der muffigen verwohnten dunkeln Zimmer ist Kafkas Welt. (. . .) Potemkin aber, der halb schlafend und verwahrlost, in einem abgelegenen Raum, zu dem der Zugang untersagt ist, dahindämmert, ist ein Ahn jener Gewalthaber, die bei Kafka als Richter in den Dachböden, als Sekretäre im Schloss hausen, und die, so hoch sie stehen mögen, immer Gesunkene oder vielmehr Versinkende sind, dafür aber noch in den Untersten und in den Verkommensten – den Türhütern und den altersschwachen Beamten – auf einmal unvermittelt in ihrer ganzen Machtfülle auftauchen können. Worüber dämmern sie dahin? Vielleicht sind sie Atlanten, die die Weltkugel in ihrem Nacken tragen?(. . .) Vielfach und oft aus sonderbarem Anlass klatschen Kafkas Figuren in die Hände. Einmal wird beiläufig gesagt, dass diese Hände , eigentlich Dampfhämmer’ sind”.97
Für Benjamin steht fest, dass nirgends diese Machthaber furchtbarer sind, ,, als wo sie aus der tiefsten Verkommenheit sich erheben: aus den Vätern. (. . .) Der Vater, der die Last des Deckbetts abwirft, wirft eine Weltlast mit ihr ab. (. . .) Der Vater, der der Strafende ist, ist zugleich auch der Ankläger. Die Sünde, deren er den Sohn bezichtigt, scheint eine Art Erbsünde zu sein. (. . .) Wer aber wird dieser Erbsünde – der Sünde, einen Erben gemacht zu haben – bezichtigt, wenn nicht der Vater durch den Sohn? Somit wäre der Sündige der Sohn. Nicht aber darf man aus dem Satz Kafkas schliessen, dass die Bezichtigung sündig sei, weil falsch. Nirgends steht bei Kafka, dass sie zu Unrecht erfolgt. Es ist ein immerwährender Prozess, der hier abhängig ist(. . .). Er führt weit hinter die Zeit der Zwölf-Tafel-Gesetzgebung in eine Vorwelt zurück, über die einer der Siege geschriebenes Recht war. Hier steht zwar das geschriebene Recht in Gesetzesbüchern, jedoch geheim, und auf sie gestützt, übt die Vorwelt ihre Herrschaft nur schrankenloser. “98
Hoffnung kommt niemandem zu, folgert Benjamin, der in die Zustände hineingeraten ist, die für Kafka das Familiensystem und die Beamtenwelt darstellen (zu welchen auch ‘Das Schloss’ gehört wie ‘Die Strafkolonie’, auf welcher die Maschine, die dem alten Gesetz entspricht, dem Verurteilten Lettern in den Körper eingraviert, die ihn zerstückeln, auch wie), auch den Tieren steht Hoffnung nicht zu, ,, nicht einmaljenen Kreuzungen oder Gespinstwesen, wie das Katzenlamm oder Odradek”, die noch im Bann der Familie leben.
Nicht umsonst erwacht Gregor Samsa gerade in der elterlichen Wohnung als Ungeziefer “100 führt Benjamin aus. Menschen und Tiere innerhalb eines Systems kreuzen sich ebenfalls, ob die Grassen und Mächtigen oder die Winzigen und Machtlosen. Für Kafirn bedarf die sich fortsetzende Tatsache, dass das Sinnlose stärker ist als das Sinnvolle, so dass das Sinnvolle sinnlos ist, der symbolischen Veranschaulichung. Die Tragik kann aufgehoben werden, ja sie stimmt sogar heiter, da sie unausweichlich ist. So ist Josephine, die kleine Mäusin, zu verstehen, die trotz des zauberhaften Gesangs in die Falle gerät, da auch sie dem Gesetz untersteht. Für Benjamin gilt, was er von Kafka zitiert: ,,Etwas von der armen, kurzen Kindheit ist darin, etwas von verlorenem, nie wieder auftauchendem Glück, aber auch etwas vom tätigen heutigen Leben ist darin, von seiner kleinen, unbegreiflichen und dennoch bestehenden und nicht zu ermüdenden Munterkeit. “101 Kafkas eigene, abschliessende Erklärung, dass Josefines Tod der messianischen Erwartung gerecht wird, wiederholt die symbolische Auseinandersetzung um Sinn und Sinnlosigkeit. ,, Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel entbehren, Josefine aber, erlöst von der irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder. “102
Für Walter Benjamin stellt die Tatsache, dass sich bei Kafka Gestalten finden – die Gehilfen resp. ,,Gehülfen” (analog zum „Gehülfen” Robert Walsers)103, die ausserhalb der „Familie” und mithin ausserhalb der nicht lösbaren Paradoxie des nicht gewählten und auferlegten Lebens stehen – wie z.B. der Türvorsteher, der den Zugang zum Gesetz bewacht und der dem Hungerkünstler gegenüber weder ein Mächtiger ist noch Furcht einfiösst -, eine kleine Hoffnung dar. ,, Sie sehen, wie Kafka sagt, dem Barnabas ähnlich, und der ist ein Bote. Noch sind sie dem Mutterschoss der Natur nicht voll entlassen und haben darum , sich in einer Ecke auf dem Boden auf zwei alten Frauenröcken eingerichtet. Es war ihr Ehrgeiz, möglichst wenig Raum zu brauche, sie machten in dieser Hinsicht, immer freilich unter Lispeln und Kichern, verschiedene Versuche, verschränkten Arme und Beine, kauerten sich gemeinsam zusammen, in der Dämmerung sah man in ihrer Ecke nur ein grosses Knäuel’. Für sie und ihresgleichen, die Unfertigen und Ungeschickten, ist die Hoffnung da”. 104 Es sind vormythologische, in die die viel älteren indischen Sagenwelten verweisende Hoffnungsträger, die Benjamin bei Kafka findet, bis zurück zu den Gandharwe, ,, den unfertigen Geschöpfen, Wesen im Nebelstadium“.
Es lässt sich einwenden, dass es in Kafkas Werk noch ‘Amerika’ gibt, 1913 mit dem ‘Heizer’ begonnen, als die Beziehung zu Felice Bauer seit rund einem Jahr durch die Dichte des Briefeschreibens zu einem hoffnungsvollen Fluidum wurde, noch ausserhalb einer ängstigenden Familienstruktur wie ein Jahr später nach der ersten Verlobung, die sechs Wochen später wieder aufgelöst werden musste, um der Vaterwiederholung entweichen zu können. Walter Benjamin verknüpft’ America’ mit Kafkas Kinderbild, auf welchem der sechsjährige Knabe in einem theatralischen Kinderanzug, in der linken Hand einen übergrossen Hut, traurig dasteht„ vielleicht, nimmt Benjamin an, ,,mit dem übergrossen Wunsch, Indianer zu werden”, der nie erfüllbar sein kann, der jedoch verdrängt und umso stärker weiterwirkt, bis Kafka durch das Naturtheater von Oklahoma eine Gelegenheit auf der Rennbahn anbietet, zu welcher alle geladen sind, die sich rechtzeitig melden. Die Bedingung ist definitiv, die Einladung geschieht nur einmal, und wer die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer. Und Benjamin zitiert: ,, Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns! Jeder ist willkommen! Wer Künstler werden will, melde sich! Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort! Wer sich für uns entschieden hat, den beglückwünschen wir gleich hier! Aber beeilt euch, damit ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet! Um zwölf Uhr wird alles geschlossen und nicht mehr geöffnet!” Karl Rossmann – der „glücklicheren Inkarnation des K. “, wie Benjamin schriebt -, gelang es tatsächlich, den Eintritt ins Naturtheater von Oklahoma zu erwischen und auf diese Rennbahn zu gelangen, auf welcher nichts anderes zählte als die Lauterkeit, die Gesten zu vollziehen. ,, Wie immer man es gedanklich vermitteln mag, – vielleicht ist diese Reinheit des Gefühls eine ganz besonders feine Waagschale des gestischen Verhaltens- aufjeden Fall weist das Naturtheater von Oklahoma auf das chinesische Theater zurück, welches ein gestisches ist”105. Die Worte sind, wie Benjamin richtig erkennt, trügerisch, nicht aber die wortlosen Gesten, die für Kafka aufs genaueste wiedergeben, was die Gestalten zu vermitteln versuchen.
Doch bei Kafka verbindet mit Karl Rossmann noch mehr als das Glück, rechtzeitig Zugang zum Naturtheater zu finden. In Karl Rossmann, der als schuldloser, zur Vaterschaft missbrauchter Sechszehnjähriger erscheint, der durch die eigene Familie zum Zweck der Verhinderung von Zahlungsverpflichtungen und Schande zur Auswanderung gezwungen wurde und der beim Erblicken der Freiheitsstatue, von Zuversicht überwältigt, den Koffer einem Unbekannten zum Bewachen überliess und wieder ins Innere des mächtigen Dampfers hinunterstieg, um den Schirm zu holen, den er zurück gelassen hatte, der dabei dem Heizer begegnete, dem hilflosen, schweren Arbeiter, der um sein Recht betrogen wurde und für dessen Recht er sich einsetzen wollte, dabei im Büro des Kapitäns von Senator Jakob als dessen Neffe angesprochen wurde tatsächlich durch den nach Amerika ausgewanderten Onkel von der Mutterlinie, der ihn bei sich aufnahm und ihm ein neues Leben in Wohlstand und Sicherheit ermöglichte – Karl Rossmann ist der kindgebliebene, andere Kafirn, der in der Schulzeit davon träumte, vom Onkel von der mütterlichen Löwy-Linie, der als Geschäftsmann in Madrid lebte, eingeladen zu werden und ihm zu folgen – was nie geschah.
Hoffnung hatte für Kafirn ihren Platz in der Traumwelt „der Unfertigen und Ungeschickten”: die Reise nach Madrid fand nie statt, der ‘Amerika’ -Roman blieb unabgeschlossen, die Chinesische Mauer blieb unvollendet, Bucephalus, der neue Anwalt, der einst das Streitross Alexanders von Mazedonien war, findet niemanden, der ihn nach Indien führt. ,,Heute sind die Tore ganz anderswohin und weiter und höher vertragen; niemand zeigt die Richtung; viele halten Schwerter, aber nur um mit ihnen zu fuchteln, und der Blick, der ihnen folgen will, verwirrt sich. Vielleicht ist es deshalb wirklich das Beste, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzesbücher zu versenken. Frei unbedrückt die Seiten von den Lenden des Reiters, bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht, liest und wendet er die Blätter unserer alten Bücher. “106
„Fern dem Getöse … die Blätter unserer alten Bücher wenden”: liegt hierin die Nähe zwischen Franz Kafka und Walter Benjamin? Auf intuitiv ertastende Weise las Walter Benjamin Blatt für Blatt aus Kafkas Büchern, brachte Gestalten und Rätsel in Verbindung zu einander, kommentierte und fragte, ohne zu bewerten, schrieb Berge von Notizzetteln, von Briefen und Besprechungen zu Kafkas Bilderwelt – und was Benjamin festhielt, erschien erst vierzig Jahre nach seinem Tod. Vermutlich war er der Leser und Interpret, der Kafka am stärksten seelisch verwandt war/ist, am nächsten im Verstehen der für Kafka unentrinnbaren väterlichen Erbschaft'”, seiner eigenen, innerhalb welcher er nicht einmal der ,Wahlverwandtschaft’ bedurfte, deren Hintergründe Benjamin faszinierten, als er, knapp dreissig Jahre alt, diejenigen Goethes untersuchte.108 Neun Jahre Altersdifferenz zwischen Kafka und Benjamin bedeuten eine geringe Differenz in den Zusammenhängen der Zeitgeschichte, wenn Rückblick und Vorausblick des jüngeren und des älteren Menschen von analoger, wenngleich unterschiedlicher Klarheit sind und sich so ergänzen.
Tatsächlich stand Walter Benjamin in der Exaktheit seiner zeit- und sprachanalytischen Arbeit sowie in der Knappheit und Fülle seiner Kindheitserinnerungen und Kindergeschichten dem rätselhaft zeitenthobenen Franz Kafka sehr nah, jedoch nicht im übergriffigen Sinn eines alter ego-Anspruchs oder eines Anspruchs auf einzige Kenntnis des Werks. Die Nähe bestand tatsächlich im Sinn der späten Begleitung eines zugleich fernen und nahen Verwandten über den Tod hinaus in eine neue Präsenz. Dabei bedurften die Familienverhältnisse weder der Rücksicht noch der Preisgabe, da viele der verborgenen Knabengängste und -wünsche, die zu den Fluchtschritten des Erwachsenen im Schreiben führten, Teile einer grösseren, gemeinsamen Geschichte waren.
Auch Walter Benjamins Geschichte ist jene eines “wohlgeborenen Burgerkindes”109, wie er selber schrieb, nicht vergleichbar in den städtischen Hintergründen von Prag und von Berlin, auch nicht vergleichbar im Stadium der Assimilation, noch ungesicherte, bodenlose und somit überbestrebte Erfahrung des Übergangs aus dem ländlichen Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft für Kafkas Vater und für ihn als Sohn ( analog zur Erfahrung Freuds), während schon Benjamins Vater und Mutter – Emil Benjamin und Pauline Benjamin geb. Schönflies – in Berlin, wo Walter Benjamin am 15. Juli 1892 zur Welt kam, aufgewachsen waren. Beide grosselterlichen Familien hatten sich mehr als zwanzig Jahre vorher im aufgeklärten, von Mendelssohn geprägten Berlin niedergelassen. Drei Jahre nach Walter Benjamins Geburt kam sein Bruder Georg zur Welt, neun Jahre später seine Schwester Dora.
Walter Benjamins Vater, Emil Benjamin, 1866 im Rheinland geboren, gelang es, durch Kunsthandel sowie durch Geschäftsverbindungen mit grossen Firmen zu Reichtum zu gelangen. Ein grossstädtisch-grossbürgerliches Leben wurde so ermöglicht, mit allem, was dazu gehörte und was dem Kind die beginnende Inflation und die allmähliche politische Zersetzung Europas, insbesondere Deutschlands, hätte geheim halten sollen. Die Realität, wie sie war, auch wenn sie zu übertuschen versucht wurde, liess sich jedoch nicht abwenden. Der Fetisch wurde zum auferzwungenen falschen Kleid, unter dem Walter Benjamin sich selber fremd wurde. “.. .Ich bin entstellt vor Ähnlichkeit mit allem, was hier um mich ist. Ich hause so wie ein Weichtier in der Muschel haust im neunzehnten Jahrhundert, das nun hohl wie eine leere Muschel vor mir liegt'”!”. Ein Photo, auf welchem Walter Benjamin und sein jüngerer Bruder Georg als “Älpler” verkleidet vor einem theatralischen Hintergrund posieren, macht diese Fremdheit verständlich. (Das Photo ist jenem vergleichbar, das Franz Kafirn als Sechsjährigen mit einem Sombrero in der linken Hand, einem spanischen Kinderfürsten ähnlich, darstellt und auf welches Walter Benjamin in seiner Untersuchung von Kafkas Texten eingeht, beide benutzt zur theatralischen Bestätigung grossbürgerlicher jüdischer Assimilationj.i!’ In der Kinderzeit – trotz aller Differenzen – muss ein ähnliches Unbehagen Kafka und Benjamin erfüllt habe und zu – damals noch spielerischer – Flucht und zur Suche nach Glück bewogen haben, vor allem zum frühen Wissen, letztlich in einem neuen, anderen Ghetto allein zu sein.
„In meiner Kindheit war ich ein Gefangener des alten und neuen Westens. Mein Clan bewohnte diese beiden Viertel damals in einer Haltung, die gemischt war aus Verbissenheit und Selbstgefühl und die aus ihnen ein Ghetto machte, das er als sein Lehen betrachtete. In dies Quartier Besitzender blieb ich geschlossen, ohne um ein anderes zu wissen. (. . .) Keine andere Form der Revolte ging mir damals ein als die der Sabotage; diese freilich aus eigenster Erfahrung. Auf sie griff ich zurück, wenn ich der Mutter mich zu entziehen suchte. Am liebsten aber bei den ‘Besorgungen’, und zwar mit einem verstockten Eigensinn, der meine Mutter oft zur Verzweiflung brachte. Ich hatte nämlich die Gewohnheit angenommen, immer einen halben Schritt zurückzubleiben. Es war, als hätte ich in keinem Fall eine Front, und sei es mit der eigenen Mutter, machen wollen. Wie viel ich dieser träumerischen Resistenz bei den gemeinschaftlichen Gängen durch die Stadt zu danken hatte, fand sich später, als ihr Labyrinth sich dem Geschlechtstrieb öffnete. Der aber suchte mit seinem ersten Tasten nicht den Leib, sondern die ganz verworfene Psyche, deren Flügel faulig im Schein einer Gaslaterne glänzten oder noch unentfaltet unterm Pelz, in welchen sie verpuppt war, schlummerten. (. . .) Schon damals aber, als meine Mutter mein Brödeln und verschlafenes Schlendern schalt, spürte ich dumpf die Möglichkeit, im Bund mit diesen Strassen, in denen ich mich scheinbar nicht zurechtfand, mich später ihrer Herrschaft zu entziehn. Kein Zweifel jedenfalls, dass ein Gefühl ein trügerisches leider – ihr und ihrer und meiner eignen Klasse abzusagen, Schuld an dem beispiellosen Anreiz trug, auf offner Strasse eine Hure anzusprechen. Das Grauen, das ich dabei fühlte, war das gleiche, mit dem mich ein Automat erfüllt hätte, den in Betrieb zu setzen es an einer Frage genug gewesen wäre. “112
Bei Walter Benjamin findet sich in der Masslosigkeit nicht erfüllter Bedürfnisse jedoch weniger Verlorenheit als bei Kafka, sondern eher etwas Überströmendes. In allem, was ihn in seiner hungrigen Unruhe nach Klärung dessen bewog, was Sprache in sich trägt, was sie in sich verschliesst und was sie bewirkt, je nachdem wie sie sich öffnet, entschlüsselt und entfaltet, liess sich eine Fortsetzung des kindlichen Wunsches nach Nähe finden, nach sprachlich unverhülltem Austausch von Interesse, von Erkennen und von Verstehen. Immer ging es ihm um die geheimnisvollen Zusammenhänge des In-der-Welt-seins in der flüchtigen Jetztzeit, d.h. des Lebens und Zusammenlebens auf der schmalen Linie der Ausgesetztheit auf einer erstickend angehäuften Vergangenheit, die den Blick auf sich absorbiert, während die Zeit der nie erlebbaren Zukunft entgegensteuert. Was in der Kindheit geahnt wurde, formulierte Benjamin 1940 als einen seiner letzten Texte, die erhalten blieben.; wir werden ‘Über den Begriff der Geschichte’ noch näher eingehen.
Einzelne Angaben, wie Herkunft und Kindheit waren, findet sich beim Lesen der Aufzeichnungen, die unter dem Titel “Berliner Chronik” sowie “Berliner Kindheit um Neunzehnhundert” Erinnerungen und Überlegungen festhalten, die Walter Benjamin im vierzigsten Altersjahr zu schreiben begann, zwischen Juli und August 1932 in Ibiza, dann zwischen August und November in Italien, in Poveromo (Marina di Massa), und die er im Spätherbst des gleichen Jahres nach seiner Rückkehr nach Berlin umarbeitete und vervollständigte113. Vermutlich hat er erst 1938 die Sammlung von Aufzeichnungen als abgeschlossen betrachtet – ein langes Festhalten, Verweilen und Schildern dessen, was für ihn Ursache und Vorbereitung aller Verknüpfungen war, der geheimnisvollen, anziehenden, Geborgenheit schaffenden, Neugier und Sehnsucht weckenden Zusammenhänge rund um die Mutter, die alle Erwartungen in den späteren Frauenbeziehungen begleiteten. So schrieb er z.B. über die vielen Kinderkrankheiten, die er als etwas Wichtiges in Erinnerung behielt. ,, … Ich mass den Abstand zwischen Bett und Tür und fragte mich, wie lange noch mein Rufen ihn überbrücken könne. Ich sah im Geist den Löffel, dessen Rand die Bitten meiner Mutter besiedelten, und wie, nachdem er meinen Lippen erst so schonungsvoll genähert worden war, mit einem mal sein wahres Wesen durchbrach, indem er mir die bittere Medizin gewaltsam in die Kehle schüttete. (. . .) Meist machte meine Mutter mir das Bett. Vom Divan aus verfolgte ich, wie sie die Kissen und Bezüge schüttele, und dacht dabei an die Abende, an denen ich gebadet worden war und dann auf einem Porzellantablett das Abendbrot ans Bett bekommen hatte. (. . .) Und die Erinnerung an das Abendbrot und an die Himbeerranken war um so viel angenehmer, als der Körper sich auf immer erhaben über das Bedürfnis, etwas zu verzehren, vorkam. Dafür gelüstete ihn nach Geschichten. Die starke Strömung, welche sie erfüllte, ging durch ihn selbst hindurch und schwemmte Krankes wie Treibgut mit sich fort. Schmerz war ein Staudamm, welcher der Erzählung nur anfangs widerstand; er wurde später, wenn sie erstarkt war, unterwühlt und in den Abgrund der Vergessenheit gespült. Das Streicheln bahnte diesem Strom sein Bett. Ich liebte es, denn in der Hand der Mutter rieselten schon Geschichten, welche bald in Fülle ihrem Mund entströmen sollte. Mit ihnen kam das Wenige ans Licht was ich von meinen Vorfahren erfuhr. Die Laufbahn eines Ahnen, Lebensregeln des Grossvaters beschwor man mir herauf, als wollte man mir so begreiflich machen, wie übereilt es sei, der grossen Trümpfe, die ich dank meiner Abkunft in der Hand hielt, durch einen frühen Tod mich zu enttäuschen. Wie nah ich ihm gekommen war, das prüfte zweimal am Tag meine Mutter nach. Behutsam ging sie mit dem Thermometer sodann auf Fenster oder Lampe zu und handhabte das schmale Röhrchen so, als sei mein Leben darin eingeschlossen. – Später, als ich heranwuchs, war für mich die Gegenwart des Seelischen im Leib nicht schwieriger zu enträtseln als der Stand des Lebensfadens in der kleinen Röhre, in der er immer meinem Blick entglitt. Gemessen werden strengte an. (. . .) “.114
Doch auch die Aufzeichnungen der Selbstentfremdung und der vielfach beschwerlichen Abhängigkeiten finden sich auf diesen Seiten über die ,Berliner Kindheit um Neunzehnhundert’, die Abwehr, Gefährdung und Flucht verursachenden Bilder, verknüpft mit der unerreichbaren, ohnmachtbewirkenden Macht des Vaters – letztlich viele jener Zusammenhänge, die er schon zehn Jahre vorher in aphorismenähnlichen Notizen festgehalten und unter dem Titel “Einbahnstrasse” publiziert hatte. ,,Das bürgerliche Dasein ist das Regime der Privatangelegenheiten. Je wichtiger undfolgenreicher eine Verhaltensart ist, desto mehr enthebt es sie der Kontrolle. Politisches Bekenntnis, Finanzlage, Religion – das alles will sich verkriechen, und die Familie ist der morsche, finstere Bau, in dessen Verschlägen und Winkeln die schäbigen Instinkte sich festgesetzt haben. (. . .) Mit einer Frau bei der und der Gelegenheit sich zeigen, kann mehr bedeuten als mit ihr zu schlafen. So liegt auch bei der Ehe der Wert nicht in der unfruchtbaren ,Harmonie’ der Gatten: als exzentrische Auswirkung ihrer Kämffe und Konkurrenzen tritt, wie das Kind, so auch die geistige Gewalt der Ehe zutage. “11
Walter Benjamins Gymnasialzeit war geprägt gewesen durch die vielen Formen des Widerstands und der Gefühle der Fremdheit, die er selber erklären konnte, insbesondere die drei ersten Jahre im Kaiser-Friederich-Gymnasium in Berlin, wo Prügel und Arrest zum System gehörten. Durch das Einschreiten der Mutter gelang es, dass er für die weiteren zwei Jahre in einem Landerziehungsheim in Thüringen untergebracht wurde, wo die Theorie von Gustav Wyneckens Schulreform Umsetzung fand und wo er das erste Mal auch als jüdischer Aussenseiter einen Platz einnehmen durfte. Walter Benjamin erlebte ein Erwachen der eigenen Sicherheit, er gehörte zu einem Lese- und Diskussionszirkel und publizierte in der Schülerzeitschrift “Der Anfang” erstmals Texte, zu seinem eigenen Erstaunen. Doch die erholende Zeit wurde auf das Drängen des Vaters beendet; erneut war es das Berliner Gymnasium am Savignyplatz, wo er verspätet im Frühling 1912, mit 20 Jahren, die Abiturprüfungen bestand.
Beim Neukantianer Heinrich Rickert in Freiburg i.Br. begann Walter Benjamin das Philosophiestudium. Ausschlaggebend wurde der Einfluss Nietzsches, aber auch derjenige Kants, später insbesondere Hermann Cohen. Kontakte ergaben sich mit zionistischen Jugendorganisationen, weckten in ihm Interesse im Sinn der Vertretung eines kulturellen jüdischen Auftrags im Rahmen der europäischen Kulturen, jedoch Abgrenzung von deren politischen und gesellschaftlichen Bestrebungen. Im Zusammenhang eines aktiven kulturellen Engagements gründete Benjamin in Berlin einen “Sprechsaal”, um die offene, kritische Diskussion im Kreis ähnlich denkender Freunde und Freundinnen über kulturelle Fragen der Opposition gegen das bürgerliche Milieu und gegen den sich verengenden Nationalismus zu ermöglichen. ”Ich denke (nicht sozialistisch, sondern in irgend einem anderen Sinn) an die Menge der Ausgeschlossenen und an den Geist, der mit den Schlafenden im Bunde ist”, schrieb er 1913 an Carla Seligson.
Der Kreis, der dabei entstand, wurde für Walter Benjamin zur neuen Erfahrung von Nähe und Freundschaft, doch gleichzeitig zur schmalen, aufwühlenden Linie des Verlustes all dessen, was Halt bedeutete. Dazu gehörte der Selbstmord von Carla Seligsons Schwester Rika und von Fritz Heinle, dem jungen Dichter, im “Sprechsaal”, am 8. August 1914 nach der Kriegserklärung Deutschlands – ein Ausdruck der nicht mehr löschbaren Verzweiflung ob der Ohnmacht des Denkens gegenüber der Macht, auch ob dem Versagen der über die Sprache geschaffenen Freundschaft.
Nach dem Selbstmord des befreundeten Paares verweigerte Walter Benjamin den Kriegseinsatz und wurde aus gesundheitlichen Gründen nicht eingezogen. Im April 1917 heiratete er Dora Pollak Kellner, die Tochter des Zionisten Leon Kellner aus Wien (die vorher verheiratet gewesen war mit dem Journalisten Max Pollak). Das Paar zog in die Schweiz, liess sich nach Aufenthalten in St. Moritz und Zürich in Muri bei Bern nieder, wo im April 1918 der Sohn Stefan zur Welt kam. Walter Benjamin begann, sich mit der Untersuchung der Ursachen und Zusammenhänge des Zusammenbruchs der bürgerlichen Gesellschaft zu befassen, die mit dem Krieg ein untrügerisches Ausmass bekundete, auch zunehmend mit den metaphysisch-gottsuchenden Fragen der Romantik, immer wieder mit Fragen der Sprachphilosophie und der Kunst.
Im Zusammenhang der Zeitfragen wurden Freundschaftsbeziehungen mit regem wissenschaftlichem Austausch zunehmend wichtiger: mit Georg Lukacs, mit Ernst Bloch, mit Gershom Sholem, der den Sommer 1918 bei den Benjamins in Muri bei Bern verbrachte und mit dem er – aus Schalk oder Ironie – die Universität Muri gründete. Nach Bestehen der Doktorprüfung, im Winter 1919/20, zog er mit Frau und Sohn nach Österreich, lebte in Wien, arbeitete weiter am “grossen Problemkreis Wort und Begriff (Sprache und Logos)”, blieb in finanzieller Hinsicht weiterhin abhängig von seinem Vater, da er als “Privatgelehrter” arbeiten wollte und sich weigerte, eine Berufsausübung nach väterlichem Modell zu beginnen. Infolge der Inflation kam es zum Umzug nach Berlin in die elterliche Villa, zum nicht mehr tragbaren Zerwürfnis mit dem Vater, zu Habilitationsplänen, gleichzeitig zum Beginn des Hebräischstudiums, das er wieder abbrach, auch zum Beginn der Übersetzung von Baudelaire’s ‘Tableaux Parisiens’, sodann zur Herausgabe einer Literaturzeitschrift, die “Angelus Novus” hiess116
In der ersten – und einzigen – Nummer der ‘Angelus-Novus’- Zeitschrift veröffentlichte Benjamin seinen Aufsatz über ‘Die Aufgabe des Übersetzers’ 117 als welchen er sich selber empfand. Die Sprache bedeutete für Benjamin generell Übersetzung: Übersetzung seiner zugleich sprachphilosophisch-zeitkritischen, dichterisch-theologischen und kunstorientierten persönlichen Erkenntnis. ,,Den es gibt ein philosophisches Ingenium, dessen eigenstes die Sehnsucht nach jener Sprache ist, welche in der Übersetzung sich bekundet. (. . .) Auch im Bereich der Übersetzung gilt: am Anfang war das Wort. (. . .) Es bleibt in aller Sprache und in ihren Gebilden ausser dem Mitteilbaren ein Nicht-Mitteilbares, ein, je nach dem Zusammenhang, in dem es angetroffen wird, Symbolisierendes oder Symbolisiertes. Symbolisierendes nur in den endlichen Gebilden der Sprachen; Symbolisiertes aber im Werden der Sprachen selbst.“ Als Beispiel ging Benjamin auf Hölderins Sophokles- Übersetzungen ein, dessen letztes Werk, in denen „ der Sinn von Abgrund zu Abgrund stürzt, bis er droht, in bodenlosen Sprachtiefen zu versinken. Aber es gibt ein Halten. Es gewährt es jedoch kein Text ausser dem heiligen, in dem der Sinn aufgehört hat, die Wasserscheide für die strömende Sprache und die strömende Offenbarung zu sein. (. . .) In irgendeinem Grade enthalten alle grossen Schriften, im höchsten aber die heiligen, zwischen den Zeilen ihre virtuelle Übersetzung. Die Interlinearübersetzung des heiligen Textes ist das Urbild oder Ideal aller Übersetzung. “118
Dass Walter Benjamin mit vierzig Jahren – nach dem Tod seines Vaters, nach dem Auszug aus dem Haus seiner Mutter in Berlin, nach deren Tod, nach der Scheidung von seiner Ehefrau Dora und seinem Sohn Stefan 119, nach vielem mehr, was nur kurz erwähnt werden kann – sich im Zusammenhang von “Berliner Chronik” resp. “Berliner Kindheit” erlaubte, in der Ich-Form zu schreiben, was er sich sonst nur in Briefen zugestand, macht deutlich, wie sehr er der Sprache bedurfte, um den für ihn klärenden Dialog mit seiner Geschichte zu finden, ob es um ihn oder nicht um ihn selber ging, um Anderes oder um Andere – gerade um Franz Kafirn, um Robert Walser u.v.m. Das schwierigste “Andere” war die Gesellschaft, wie sie Benjamin in der Kindheit an grossen Einladungen im Elternhaus präsentiert worden war und wie sie sich mit Intrigen und Anpassungsforderungen, mit tödlichem Gerangel um Fortschritt und Macht fortsetzte; der eigentlich “Andere” blieb die Gestalt des furchterregenden Vaters, selbst nach dessen Tod.
Obwohl mit dem Erscheinen einzelner Essays Benjamins Bedeutung als Schriftsteller und Denker anstieg, blieb er ständig in materieller Not, instabil zwischen den Städten reisend, ständig schreibend, auch an einer geplanten Habilitation, die infolge des zunehmenden Antisemitismus nicht zustande kam, mit Studierenden in intensivem Austausch, so mit Wiesengrund-Adorno, später mit Max Horkheimer, ein langer Aufenthalt in Capri, die Arbeit an den Zusammenhängen des Trauerspiels, dieser “tollsten Mosaiktechnik, die man sich denken kann, ein Spiel von Traurigen, denen auf der Bühne der katastrophale Verlauf ihrer eigenen Geschichte und der der Weltgeschichte vor Augen geführt wird”, eine neue Liebe120, eine lange Reise auf einem Frachtdampfer von Norddeutschland nach Spanien, Übereinkunft mit einem Verlag, Marcel Prousts grosses Werk “Sodome et Gomorrhe” zu übersetzen, ruhelos unterwegs, schliesslich ab 1926 Beginn des Lebens in Paris, ohne feste Sicherheit, fasziniert von der Stadt, von der Arbeit des sprachlichen, örtlichen und zeitkritischen Erforschens, der Begegnungen und Gespräche, Ort der Intensität und der Faszination, wo die Arbeit an dem von ihm geplanten “Passagen”-Werk. im Zusammenhang einer neuen Geschichtstheorie über das 19. Jahrhundert begann und sich bis zum Lebensende fortsetzte. Ständig in einem schwierigen Verhältnis mit der Frankfurter Schule, mit der “Frankfurter Zeitung” und mit anderen Redaktionen – allmählich in einem Zustand immer stärkerer psychischer Belastung. Es war über die Sprache, dass Benjamin an sich selber fest hielt und an dem, was sein “linkes Aussenseitertum” bedeutete, worin sich sein Denken und seine Empfindungen zusammenballten, es war dank der Sprache, dass er sich Lebensinhalt schuf.
Als mit der sich verschärfenden nationalsozialistischen Entwicklung in Deutschland – aber auch in Vichy-Frankreich und überall in Europa – die existentielle Notsituation immer klarer wurde, richtet er vergeblich einen Hilferuf an Gershom Scholem, für ihn im damaligen Palästina eine Erwerbs- und Lebensmöglichkeit zu schaffen, und ebenso wenig setzten sich Adorno und Horkheimer für ihn ein, damit ihm mit Hilfe einer Einladung ans New Yorker Institut ein Visum in die USA ermöglicht worden wäre. Seine Schwester Dora hatte sich zu ihm nach Paris geflüchtet und wurde schwer krank; sein Bruder Georg, ein engagierter Arzt und Kommunist, wurde schon 1933 in deutsche “Schutzhaft” abgeführt und vier Jahre später in Mauthausen ermordet. Allein die Sicherheit seiner von ihm geschiedenen Frau Dora und seines Sohnes Stefan, die über Italien nach London hatten fliehen können, stand nicht in Frage. “Ich lebe in Erwartung einer über mich hereinbrechenden Unglücksbotschaft”, hielt er im April 193 9 fest, arbeitete jedoch weiter an der Übersetzung der Baudelaire-Gedichte und an der Neustrukturierung seines grossen Passagen-Werkes, schliesslich an seinem Essay “Über den Begriff der Geschichte”, der zu einer Art Testament wurde. Worin bestand der Sinn als dessen, was geschehen war und das sich vorweg auf die Zukunft ausrichtete? ,, Glück, das Neid in uns erwecken könnte, gibt es nur in der Luft, die wir geatmet haben, mit Menschen, zu denen wir hätten reden, mit Frauen, die sich uns hätten geben können. Es schwingt, mit anderen Worten, in den Vorstellung des Glücks unveräusserlich die der Erlösung mit. Mit der Vorstellung von Vergangenheit, welche die Geschichte zu ihrer Sache macht, verhält es sich ebenso. Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die Früheren gewesen ist? – ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun verstummten? – haben die Frauen, die wir umwerben, nicht Schwestern, die sie nicht mehr gekannt haben? Ist dem so, dann besteht eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unseren. Dann sind wir auf der Erde erwartet worden. Dann ist uns wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Billig ist dieser Anspruch nicht abzufertigen. “121
Für Walter Benjamin wurde die Dringlichkeit, ein tragbares Bild von Geschichte zu schaffen, nach dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 unaufschiebbar. .Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen; und dadurch wird unsere Position im Kampfgegen den Faschismus sich verbessern. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, dass die Gegner ihm im Namen des Fortschritts als einer historischen Norm begegrzen. – Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im zwanzigsten Jahrhundert ‘noch’ möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist. “122
Benjamin war durch die Beamten der Vichy-Regierung in einem Sammellager in Nevers interniert worden, wurde jedoch dank der Intervention von Freunden – unter ihnen Jules Romain – Ende November wieder entlassen. Benjamin erinnerte sich an das kleine Gemälde von Paul Klee, das er 1920 erworben hatte und das den Angelus Novus darstellt. War nicht durch dieses Bild die Übersetzung dessen möglich, was den Zusammenhang von Geschichte unter der Vorgabe von ‘Fortschritt’ beinhaltete? ,,Es gibt ein Bild von Paul Klee, das Angelus Novus heisst. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel steigt. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. “123
Für Walter Benjamin stand fest, dass, was als Fortschritt bezeichnet wurde, aus Trümmerhaufen bestand. Die Geschichte als Ablauf von Fortschritt konnte dem Abbau der Trümmer nicht gerecht werden, da die Verantwortlichen für Politik „ nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahr haben. “Die technokratischen Züge, die sich im Faschismus und im Nationalsozialismus, in jeder Art von Diktatur in Namen des Fortschritts verfestigen, beruhen, wie Benjamin festhält, auf dem Mitläufertum jeder Art von politischer Gruppierung, auch jener der Sozialdemokratie, die sich der Ausbeutung – sei es jener der Menschen oder jener der Natur – nicht entgegenstellen. Der Spartacus-Bund – Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Karl Liebknecht u.a.m. – mit dem Wagnis des Widerstands gegen das unkritische Mitläufertum der Sozialdemokratie konnte jedoch das Kontinuum der Geschichte nicht aufsprengen, Der Blick des Engels blieb daran haften, da die Jetztzeit Teil der Geschichte ist. In der Jetztzeit den messianischen Teil zu erkennen, der in jedem Augenblick mitschwingt, steht jedem Menschen selbst zu. Walter Benjamin wollte die kleine Hoffnung, die ihm blieb, nicht aufgeben.
Als im Mai 1940 die deutschen Truppen über Holland und Belgien in Frankreich einmarschierten, war keine Sicherheit mehr gewährleistet; er floh er mit seiner Schwester nach Südfrankreich. Die Manuskripte zum Passagenwerk hatte er Georges Bataille übergeben, andere Aufzeichnungen (darunter ‘Über den Begriff der Geschichte’) Hannah Arendt überlassen, die – dank der Intervention des ersten Ehemannes Günther Stern (Günther Anders) – mit ihrer Mutter und ihrem Mann Heinreich Blücher ein Visum für die Flucht in die USA hatte. Zahlreiche Manuskripte blieben in seinem Zimmer in Paris zurück und wurden von der Gestapo beschlagnahmt. Was Walter Benjamin in einem Koffer mit sich schleppte, als er mit einer Gruppe von Flüchtlingen versuchte, unter der Führung von Lisa Fittko124 über die Pyrenäen nach Spanien zu gelangen, kann nicht entschlüsselt werden. Der Koffer ging verloren. Spanien wies die Flüchtlinge zurück, die über kein französisches Ausreisevisum verfügten. Walter Benjamin mochte nicht mehr weiter fliehen, konnte nicht mehr weiter fliehen. In der Nacht vom 26./27. September 1940 nahm er sich in Port Bou mit einer Überdosierung Morphium das Leben. Ein Grab von ihm gibt es nicht, nur einen Hinweis, dass hier Walter Benjamins Leben zu ende ging.
Das Werk Walter Benjamins vermittelt einen leidenschaftlich herumirrenden Sucher und Übersetzer, der durch die unablässige Benutzung aller Teile des ihm eigenen Lebensfächers, der “Sprache” heisst, den Hunger nach Zugehörigkeit und nach Vertrautheit offenbart. Mittels der Sprache suchte Walter Benjamin für sein gesellschaftskritisches Streben einen Rückhalt zu finden – ein utopisches Streben, das nach der optimalen Übereinstimmung eines marxistisch-gesellschaftsethischen Regelsystems mit den ästhetischen Forderungen einer ich- symbiotischen, den Gefühlen tongerecht entsprechenden Übersetzung des individuellen Erkennens und Denkens trachtet. Benjamins Betrachtungen, Aufsätze und Abhandlungen sind emotional dichte, zugleich dichterisch bildhafte und vielseitig wissenschaftliche Vermittlungen seiner Unruhe und Sehnsüchte, auf spürbar erschöpfende Weise eine fast pausenlose Wiedergabe des nie erfüllbaren Suchens nach vollkommener Übereinstimmung nicht erfüllbarer Bedürfnisse – insbesondere jenes nach Sicherheit, nach Schönheit und nach Wahrheit, letztlich nach Glück-, immer Ausdruck leidvoller Erfahrungen von Mangel auf Grund schwer lösbarer Abhängigkeiten und nicht erreichbaren Aufgehobenseins in der eigenen Freiheit, eines Lebens, das durch lauter Passagen eilt und in einer Passage mündet.
Die Frage stellt sich, wie Walter Benjamin zur Dichte und zur Komplexität der Bemühungen kam, die Sprache in ihrer ganzen schöpferisch-orchestralen Bedeutung, wie sie ihm bewusst war, sowie im Ausdruck jeder Art von dichterischer Komposition zu verstehen und, indem er das, was er zu verstehen dachte, so zu übersetzen, dass auch Werke von einer Sprache in eine andere verstanden werden konnten? Wie kam er insbesondere zu der ihn besetzenden Aufgabe, die Auswirkungen der Sprache auf kollektive Entwicklungen, resp. auf die Geschichte der Modeme zu untersuchen, um die Folgen der zu politischen Zwecken benutzten Sprache zu verstehen? Warum aber geschah jede Art der Untersuchung ohne Zweifel in der ihm eigenen Sprache, so dass jedes noch so kleine Benjamin’sche Schriftstück in der Fülle von Themen, die er als schreibender Denker angetragen bekam, die er aufgriff oder die für ihn von ständiger, sich fortsetzender Bedeutung waren, zu einem persönlichen Psychogramm wird? Wie erklären sich die Intensität, die Masslosigkeit und gleichzeitig die Verlorenheit Walter Benjamins?
Es war die Sprache, die für Benjamin letztlich das Lebensferment bedeutete: zugleich stärkende Nähe im Rückzug zu sich selbst und Ausweg aus der Einsamkeit ins Sprechen über das Schreiben. Der Weg in die Sprache war verbunden mit dem Weg über andere Sprachen zur eigenen Sprache, zuerst Wege der Suche nach der eigenen Identität infolge der Verlorenheit in der Kindheitsgeschichte, des Nicht-Verstehens und Nicht-Verstandenseins in der sprachlichen Fremdheit der Familie, in welcher die übermächtige Vaterfigur den Ton und das Schweigen bestimmt hatten. Doch im Gegensatz zu Franz Kafka erschien es Walter Benjamin möglich, die väterliche Erbschaft anders als durch das Verstummen zu deuten.
Denn ausschlaggebend für die Verbote und Gebote in der Familienstruktur, in welcher Walter Benjamin seine Kindheit verbracht hatte, war der Anpassungsdruck an die kapitalistisch- bürgerliche Gesellschaft, das Hintanstellen oder gar Leugnen der jüdischen Herkunftsgeschichte mit dem von Mythologien geprägten Traditionszusammenhang im Jahresablauf und in der Alltagsgestaltung. Die Muttersprache wurde von der Vatersprache zum Verstummen gebracht. Zwar hatte Benjamin die Zärtlichkeit seiner Mutter erlebt, die zwar machtlos war, die aber in den Tagen und Abenden der zahlreichen Kindererkrankungen in seiner Nähe sass und ihm mit leise klingender Stimme Geschichten erzählte. Er hatte das Glück der Nähe erlebt, das immer wieder abgebrochen werden musste und das mit dem Erwachsenwerden unstillbar als Hunger in ihm blieb. Doch lag nicht im Erzählen ein Heilungsangebot, das zu nutzen war? .Die Heilung durch Erzählen kennen wir schon aus den Meeresburger Zaubersprüchen. Auch weiss man ja, wie die Erzählung, die der Kranke am Beginn einer Behandlung dem Arzte macht, zum Anfang eines Heilprozesses werden kann. Und so entsteht die Frage, ob nicht die Erzählung das rechte Klima und die günstige Bedingung manch einer Heilung bilden mag. Ja, ob nicht jede Krankheit heilbar wäre, wenn sie nur weit genug – bis an die Mündung – sich auf dem Strom des Erzählens verflössen liesse? “125
So mag sich erklären, was Benjamin bewogen hatte, auch unter den Bedingungen der ideologisch und technokratisch verfinsterten Zeit die Sprache als das Land zu bewohnen und zu benutzen, zu welchem er sich bekennen konnte, das sein Fluchtland schlechthin wurde, ein von Bildern und Klangregistern, von Wurzeln und Flüssen überwuchertes und durchsponnenes Land, das sich ihm zunehmend als dichter und besetzter erschloss, je mehr er davon erfasste und besass. Er unterzog sich nicht dem Gebot der strengen Beschränkung seiner Schritte und Wege, sondern öffnete sich mit der Sprache Türen zu den verborgenen – zeitgeschichtlich nicht konformen – Geschossen und Räumen seiner quälenden Sehnsucht nach dem erfüllenden Eintreten in die Geschichte und zugleich in die nie erlebbare Zukunft – in Heimat und Ziel seines herumirrenden Ichs. In allen Zusammenhängen, die Benjamin im Benutzen seines Sprachlandes zum Erkunden und zum Erklären unternahm, besetzte er es mit den Spuren seiner Erinnerung an den Heilungsprozess in der Kindheit, oft sich verirrend in seiner Versessenheit auf der Suche nach den Momenten des Glücks, verbunden mit dem Ton der Muttersprache, die er ahnte, die er immer wieder zu finden hoffte. War es der Dialog mit dem absenten Volk im Land, in welches er sich geflüchtet hatte? – mit der absenten Liebe der Geliebten, die immer wieder verloren ging? – mit der besetzenden Namenlosigkeit, die um die messianische Botschaft kreist und die Zukunft darstellen soll, weder weiblich noch männlich? – letztlich mit der erschöpfenden Sehnsucht nach Sicherheit seines eigenen Ichs in der Verzweiflung der monologischen Suche nach dem dialogisch übereinstimmenden, eigenen Du?
Als Benjamin in der Sommerhitze von 1940 Paris verlassen musste, nach Südfrankreich gelangte, den Nachtweg über die Pyrenäen nach Spanien auf sich nahm, jedoch von Spanien nicht angenommen wurde, da wurde er zum Greis, sprachlos. Keine Aufzeichnung blieb von seinen letzten Gedanken. Oft hatte er sich damit befasst – mit dem, was Ende und zugleich Anfang heisst. Schon im April/Mai 1932 hatte er in der „Ibizenkischen Folge” festgehalten: ,, Wer einmal einsam einen Berg erstieg, erschöpft da oben ankam, um sodann mit Schritten, welche seinen ganzen Körperbau erschüttern, sich bergab zu wenden, dem lockert sich die Zeit, die Scheidewände in seinem Innern stürzen ein und durch den Schotter der Augenblicke trollt er wie im Traum. Manchmal versucht er stehen zu bleiben und kann es nicht. Wer weiss, ob es Gedanken sind, die ihn erschüttert, oder rauhe Weg? Sein Körper ist ein Kaleidoskop geworden, das ihm bei jedem Schritt wechselnde Figuren der Wahrheit vorführt. “Und in einer anderen Notiz aus dem gleichen Zeitabschnitt notierte er die Hoffnung, die ihm vielleicht wieder wach wurde, als er in Port Bou seinen Weg als beendet betrachtete: ,,Es gibt bei den Chassidim einen Spruch von der kommenden Welt, der besagt: Es wird dort alles eingerichtet sein wie bei uns. (. . .)Alles wird sein wie hier, nur ein klein wenig anders. So hält es die Phantasie. Es ist nur ein Schleier, den sie über die Ferne zieht. Alles mag da stehen wie es stand, aber der Schleier wallt, und unmerklich verschiebt es sich darunter.” 126
Im Gegensatz zu Kafirn hatte Walter Benjamin die väterliche Erbschaft, die ihm schwer und belastend erschien, auf dialektische Weise zu ertragen versucht, im Sinn der Gestaltung eines Werks. ,, Oft hat man sich die Entstehung der grossen Werke im Bild der Geburt gedacht. Dieses Bild ist ein dialektisches; es umfasst den Vorgang nach zwei Seiten. Die eine hat es mit der schöpferischen Empfängnis zu tun und betrifft im Genius das Weibliche. Dieses Weibliche erschöpft sich mit der Vollendung. Es setzt das Werk ins Leben, dann stirbt es ab. (.. .) Nun aber ist diese Vollendung des Werks– und das führt auf die andere Seite des Vorgangs – nichts Totes. Sie ist nicht von aussen erreichbar; Feilen und Bessern erzwingt sie nicht. Sie vollzieht sich im Innern des Werkes selbst. Und auch hier ist von einer Geburt die Rede. Die Schöpfimg nämlich gebiert in ihrer Vollendung den Schöpfer neu. Nicht seiner Weiblichkeit nach, in der sie empfangen wurde, sondern an seinem männlichen Element. Beseligt überholt er die Natur: denn dieses Dasein, das er zum ersten Mal aus der dunkeln Tiefe des Mutterschosses empfing, wird er nun einem helleren Teil zu danken haben. Nicht wo er geboren wurde, ist seine Heimat, sondern er kommt zur Welt, wo seine Heimat ist. (.. .) ” 127
So mag deutlich werden, dass es in Benjamins Werk128 kaum eine Abgrenzung zwischen Dichtung, Erzählung und Philosophie gibt, kaum zwischen Denken und Empfinden, Sprache und Leben, im Gegenteil. Es ist eine Verschichtung im Suchen nach Erkennen und Wissen, die an mythologische Theologie erinnert: ein Fragen und Erkunden, ein Deuten und Bekennen, als sei die Sprache für ihn – bis zum Verlassen des Lebenslandes, bis zum Verstummen – immer Übersetzung des in Psyche und Intellekt mit dem Menschlichen durchmischten Göttlichen geblieben.
96 Grigori Alexandrowitscg Potjomkin, Fürst Tawritscheski ( 173 9-17919, wurde auch als „Zyklop” am Hof von Katharina II bezeichnet, übergross, überstark und überfromm, der viermal mehr ass als andere Menschen, unzugänglich für andere Beamte, der der Fürstin auf der Reise in die Krim die Dörfer zu zeigen versprach, die sie nicht kannte und die es vielleicht nicht gab etc.
97 Benjamin über Kafka. Hrsg. Hermann Schweppenhäuser. Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages. Potemkin. Suhrkamp Verlag, Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt a. M. 1981, S. 10
98 cf. 97) Potemkin, S. 13
99 Die Figur Odradek (ev. zur Hälfte verkürztes Anagramm von Dodekaeder), die aus Fäden, in einen winzigen Zwirnstern aufgewickelt, mit einem Stäbchen irgendwie als Halt, lässt Kafka in ‘Die Sorge des Hausvaters’ sich durch das Haus bewegen und mal antworten, mal nicht, wenn sie angesprochen wird; sie ist nicht ein Nichts, doch auch kein Wesen, vergleichbar den hüpfenden Bällchen in ‘Blumenfeld, ein älterer Junggeselle’.
100 cf. 97), S. 15
101 cf. 97), S. 16
102 Franz Kafka. Erzählungen (1. Auflage 1935), S. 216
103 Franz Kafka kannte Robert Walsers Publikationen und verehrte sie, so wie ihm jene Kierkegaards nahe standen.
104 cf. 97), S. 15
105 cf. 97), 18
106 Franz Kafirn. Erzählungen. Aus: Ein Landarzt. Der neue Advokat. (Meinem Vater gewidmet), 1. Auflage 1935, S. 111
107 Es ist nicht Max Brod, den ich als den sorgfältigsten Interpreten betrachte. Zwar hat Max Brod, der mit Kafirn in Prag Jura studierte, als „Testamentvollstrecker” einen grossen Teil von Kafkas Werk herausgegeben, doch dass er sich als den alleinigen, ja als den „intimen” Kenner des früh verstorbenen Freundes erklärt, damit als allein berechtigt, ihn zu beurteilen -als „Heiligen” – und dessen Werk zu kommentieren – ausschliesslich gemäss seiner zionistischen, gemäss Brod “realistisch-jüdischen Deutung“ , diese Art von Besitzanspruch hat etwas Übergriffiges, das sowohl die Biographie (Franz Kafka. 1. Auflage Prag 1937) prägt wie die weiteren Abhandlungen (z.B. Franz Kafkas Glauben und Lehre. 1. Auflage Winterthur 1948).
108 1921-22 geschrieben, cf. Walter Benjamin. Illuminationen. Suhrkamp-Taschenbuch, Frankfurt a. M. 1977, S. 80-135
109 so vermerkt in “Berliner Chronik”, S. 7. Hrsg. von Gershom Scholem, Frankfurt a.M. 1970.
110 cf. 109)
111 cf. Benjamins Deutung der Ursachen von Kafkas ,America’ -Roman.
112 Walter Benjamin. Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Gesammelte Schriften, Bd. IV-1, S. 287
113 Angaben zu diesen Aufzeichnungen erlaubte sich Walter Benjamin sowohl im Briefwechsel mit Adorno wie in jenem mit Gershom Scholem, jedoch vor allem in Zusammenhang mit seinen Enttäuschungen, dass “die Aussichten, sie als Buch erscheinen zu sehen, enttäuschend sind” (28. 2. 1933). Trotzdem vertiefte er sich während seines zweiten Aufenthaltes in Ibiza von April bis Oktober 193 3 erneut mit dem “Kinderbuch”, wie er seine Aufzeichnungen in einigen Briefen bezeichnete – in dieser Zeit auch teilweise mit deren Übersetzung ins Französische (gemeinsam mit Jean Selz).
114 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Bd. IV-1, S. 269-271
115 Einbahnstrasse. Wettannahme. cf. 108), S. 144
116 “Angelus Novus” nach dem 1920 gekauften Bild von Paul Klee, einem Bild, dessen Bedeutung Walter Benjamin immer wieder für sich selber “übersetzte”: den “Engel” verstand er letztlich als Symbol seiner selbst, im talmudischen Sinn der ständig präsenten kritischen Erkenntnis. – Benjamin wird in seinem letzten Text ‘Über den Begriff der Geschichte’ nochmals darauf eingehen.
117 Auch den Aufsatz “Zur Kritik der Gewalt” wie jenen über Goethes “Wahlverwandschaften” plante Benjamin für seine Zeitschrift zu schreiben; wurden schliesslich in Hugo von Hoffmantsthals “Neuen Deutschen Beiträgen” veröffentlicht. Den Essay über die “Wahlverwandtschaften” widmete er Julia Cohn, der Bildhauerin und Marxistin, deren “pflanzenhafte Passivität und Trägheit”, wie er schrieb, ihn schon vor seiner Ehe mit Dora fasziniert hatte, die ihn, als sie in Berlin erschien, mit erotischer Leidenschaft besetzt hielt. Es kam zur mehrmaligen Trennung von Dora und seinem Sohn, schliesslich 1930 zur Scheidung.
118 In ‘Illuminationen’ cf. 108), S. 50-62
119 cf. 117)
120 mit der russischen Emigrantin Asja Lacis (der er die unter dem Titel “Die Einbahnstrasse” gesammelten Überlegungen widmet)
121 cf. 108), S. 151-261
122 ibid.121)
123 ibid. 121)
124 Lisa Fittko. Mein Weg über die Pyrenäen. Erinnerungen 1940/41. Carl Hanser Verlag, München/Wien 1985
125 aus: Illuminationen. Denkbilder, cf. 108), S, 309
126 In Illuminationen, cf. 108). Ibizenkische Folge. Bergab, S. 324
127 Cf. 108). Kleine Kunst-Stücke. Nach der Vollendung, S. 315-316
128 Auswahl empfehlenswerter Literatur (alphabetisch):
- Adorno-Benjamin. Briefwechsel 1928-1940. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1994
- Jörn Albrecht. Literarische Übersetzung. Geschichte-Theorie-Kulturelle Wirkung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998
- Benjamin-Scholem. Briefwechsel. 1933-1940. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1980
- Karl Brose. Sprachspiel und Kindersprache. Studien zu Wittgensteins ‘Philosophischen Untersuchungen.
- Jacob Katz. Zur Assimilation und Emanzipation der Juden. Wissenschaftliche Buchgesellschaft:, Darmstadt 1982
- J.-P. Schobinger. Variationen zu Walter Benjamins Sprachmeditationen. Verlag Schwabe & Co, Basel/Stuttgart 1979
- Detlev Schöttker. Norbert Elias & Walter Benjamin. Ein unbekannter Briefwechsel und sein Zusammenhang. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, S. 582 ff. heft 7, 42. Jhrg., Juli 19188
Auswahl Publikationen von Maja Wicki-Vogt zu Philosophie/Kommunikation/Assimilation/Exil u.a.:
- Simone Weil: Eine Logik des Absurden. Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart 1983
- ‘Die revolutionäre Tat ist, laut zu sagen, was ist’. Über politische Stummheit und politische Sprache. Drei Beispiele von Frauen – ausserhalb der Schweiz. In: Politische Sprache in der Schweiz. Orell Füssli Verlag, Zürich(Köln 1993
- Beiträge zu einer Philosophie der Dialogik im Werk von Rosa Luxemburg, Simone Weil und Hannah Arendt. In: Perspektiven der Dialogik, Hrsg, Willi Goetschel. Passagen Verlag, Wien 1994
- ‘Irdischer Heimat verirrter Schein’. Maragarete Susman: Exil als Chance. In: Siehe, ich schaffe Neues. Hrsg. D. Brodbeck, Y.Domhardt, J.Stofer. eFeF-Verlag, Bern 1998
- Ethik der Kommunikation und des politischen Handelns: Hannah Arendt. In: Geschichte der neueren Ethik. Hrsg. Annemarie Pieper. Franche Verlag, Tübingen/Basel 1992
- Von Glücke! von Hameln zu Hannah Arendt. Jüdische Frauen zwischen Tradition und Modeme. In: Neue Wege, 93. Jahrgang, Nr.7/8,Zürich, Juli/August 1999
- Wo ist der Ort der Erinnerung? In: Entwürfe. Nr. 18, Zürich 1999
- Wie steht es mit dem Herzen der ‘herzlosen’ Medea? In: Realismus der Utopie. Hrsg. Ueli Mäder/ Hans Saner. Rotpunktverlag, Zürich 2003
- Simone Weil. Kontingenz im Widerspruch der Identität. In: Philosophinnen des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Regine Munz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004 – u.a.m.








