Von Glückel von Hameln zu Hannah Arendt – Jüdische Frauen zwischen Tradition und Moderne
 Wird geladen …
Wird geladen …
auch publiziert als Magazinbeitrag in: Neue Wege – Beiträge zu Christentum und Sozialismus, Juli/August 1999
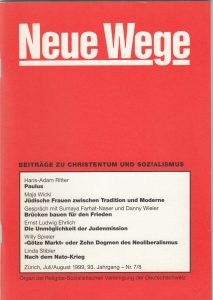
Von Glückel von Hameln zu Hannah Arendt
Jüdische Frauen zwischen Tradition und Moderne
150 Jahre Israelitische Gemeinde Biel
Sind Tradition und Moderne vereinbar? Was sich heute angesichts grosser gesellschaftlicher Umwälzungen wie eine neue Frage stellt, bedeutete seit Jahrhunderten für jüdische Frauen die die Frage des persönlichen Wegs, ohne dass sie damit die Zugehörigkeit zum Judentum in Frage gestellt hätten. Vielen von ihnen, ob sie im 17. Oder im 20. Jahrhundert lebten, gelang es mit grosser Eigenständigkeit, zugleich “treu ihrem Glauben, treu ihrem Volk und treu zu sich selbst zu sein”, wie Berta Pappenheim über Glückel von Hameln schrieb, wobei mit “treu zu sich selbst” die Zustimmung zum eigenen Wissens- und Tätigkeitshunger gemeint ist, zu den eigenen Entfaltungsmöglichkeiten und -wünschen, zu einer Existenz auch “draussen” in der “Welt”, eventuell selbst der eigenen Zeit voraus – kurz, zu einem Leben, das von einer jahrhundertealten patriarchalen Ordnung her nur den Männern zustand, für die Frauen aber als unschicklich galt. „Schicklichkeit“ und „Unschicklichkeit“ waren nicht mehr gesellschaftliche Kriterien des richtigen oder unrichtigen Handelns vom Augenblick an, wo die einzelnen Frauen Selberdenken und Eigenverantwortung den disziplinierenden und kontrollierenden patriarchalen Verhaltensvorschriften entgegenstellten, resp. diese von der Frage der Religion und der Herkunft unterschieden. Gerade dies kennzeichnete den Aufklärungsgehalt der Moderne. Dabei haben Emanzipation, Assimilation und Akkulturation die jüdischen Frauen sehr unterschiedlich erfasst, und bis heute gibt es, nicht anders als in allen anderen Religionen, eine enorme Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten jüdischen Frauenlebens. Ich werde darauf eingehen, von den in der Orthodoxie tradierten Gestaltungsmöglichkeiten bis zu den frei gewählten. Jedoch möchte ich gleich von Anfang an damit klarmachen, dass jüdische „Tradition“ einerseits und „patriarchale“ Ordnung andererseits Verschiedenes bedeuten, und dass „Moderne“ mehr beinhaltet als Neuzeitlichkeit. Die Begriffe auseinander zu halten und deren kontextuelle, auch gesellschaftliche und politische Verwendung und zu klären, gehört zu den wichtigen philosophischen Aufgaben.
Daher möchte ich zuerst erläutern, was ich unter „Tradition“ verstehe, insbesondere unter jüdischer Tradition innerhalb der Bedingungen der europäischen Diaspora, gerade auch was die Rolle und die Aufgaben der Frauen betrifft. Anschliessend möchte ich klären, was in unserem Zusammenhang „Moderne“ heisst, und in einem dritten Teil möchte ich Ihnen die persönliche Entwicklung einiger Frauen im Spannungsfeld von Herkunft und gesellschaftlichen Veränderungen näher bringen.
„Tradition“, aus dem lateinischen „tradere“ (übergeben, überliefern) und dem daraus gebildeten Substantiv „traditio“, hat in erster Linie mit der Weitergabe von Wissen zu tun. Dabei geht es weniger um Glaubensinhalte (der Glaube ist immer die persönliche Beziehung des Menschen zu Gott), als um Herkunft und Kultur, insbesondere um die Kenntnis der Zeremonialgesetze im Tages- und Jahresablauf, sowie um die dabei zu erfüllenden geschlechtsspezifischen Aufgaben. Dieses Wissen um Herkunft und Kultur schafft jene Zugehörigkeit, die das Fortbestehen des Judentums in der Zerstreuung – in der Diaspora – bis zum heutigen Tag gewährleistet hat. Die Vielleicht ist ein kurze Erläuterung zur jüdischen Diaspora nötig, um zu verstehen, was der Lebenshintergrund der Frauen war, die ich darstellen werde.
Diaspora hatte sich schon lange vor der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 ergeben. Sie ist durch eine vierfache Verhältnishaftigkeit gekennzeichnet. Die vier Verhältnisse bestehen
1) zuerst in der Thora, d.h. im Verhältnis des Volkes zum einen Gott. Dieses Verhältnis hat die Form und Bedeutung eines – zum Monotheismus verpflichtenden – Vertrags, der unauflöslich ist und der weder vom Bestehen eines Staatswesens noch vom Bestehen des Tempels abhängt, sondern das Volk in seiner Geschichtlichkeit einbindet.
Mit der Thora und mit der Befolgung ihrer Gebote wurde/ist das erste, wichtigste und massgebliche Verhältnis geknüpft, welches das Judentum in der Zerstreuung zusammenhielt und weiter zusammenhält, ein Verhältnis, das ausschliesslich geistig definiert ist und das sich als Auserwähltheit, Erinnerung und Tradition versteht;
2) im innerjüdischen Verhältnis, resp. in der Organisation von gemeinsamem Gebet, Studium und Auslegung der Thora, von Gottesdienst, Gerichtsbarkeit, Gemeindeobliegenheiten (Rituale bezüglich Beschneidung, religiöser Unterricht der Knaben und der Mädchen, Weiterbildung der männlichen und der weiblichen Gemeindemitglieder, Bar/Bad Mizwa, Heirat, Beerdigung etc.), ferner in der Organisation des Steuerwesens und der Wohltätigkeit, woraus sich eine besondere, über die Religion definierte Kultur entwickelte, woraus sich auch der von den Antisemiten immer wieder angegriffene „jüdische Zusammenhalt“ ergab. Seit 1948 kommt das Verhältnis zum Staat Israel hinzu. Für die Frauen gab/gibt es im innerjüdischen Bereich spezifische Aufgaben: das Führen des Haushalts gemäss den Kaschrut-Regeln, die Vorbereitung und feierliche häusliche Gestaltung der Festtage, die Erziehung der Kinder, in orthodoxen Haushalten auch das wöchentliche Brotteigopfer (indem sie vom Teig für die Sabbatbrote die Challah, ein Stücklein, absondern), sodann die Mikwah (das rituelle Tauchbad nach jeder Menstruation und nach einer Geburt), vor allem aber das Entzünden und Segnen der Sabbatkerzen. Den Frauen kommt, gewissermassen als höchste Auszeichnung, die Weitergabe des Judentums zu, da für das Jüdischsein die matrilineare Herkunft zählt;
3) im Verhältnis zu den Gastländern, zu den Nichtjuden und insbesondere zu den Antisemiten, ein Verhältnis, welches immer – ob es Zeiten der Toleranz, der Blüte oder der Bedrängnis, Verfolgung, ja der Vernichtung waren – bewirkte, dass die Juden als Minderheit, als die Anderen sich in kultureller Opposition zur Mehrheit oder zu Mehrheiten befanden und auf Grund dieser Stellung der Minderheit, häufig der Rechtlosigkeit, ihre Existenz als unsicher und bedroht, als tragisch erlebten, andererseits aus der Erfahrung dieser spezifischen Opposition heraus besondere Fähigkeiten (Skeptizismus, Witz, Solidarität untereinander und Solidarität zu anderen Menschen in Bedrängnis, ein besonders ausgeprägtes Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden etc.) entwickelten – ein Verhältnis, das auch nach der, mehr oder weniger konditional zugestandenen, öffentlich-rechtlichen Emanzipation im Zusammenhang mit der westlichen Aufklärung trotz der geforderten und jüdischerseits teilweise bereitwillig erbrachten Assimilation immer prekär war und blieb. Aus diesem Verhältnis folgten vielfältige Loyalitäts- und Persönlichkeitskonflikte, Selbsthass etc., aber auch schöpferische Umsetzungen – d.h. künstlerische Betätigungen, z.B. literarische, musikalische, malerische etc. und soziales, politisches und wissenschaftliches Engagement. Die schöpferische Umgestaltung diskriminierender jüdischer Lebensbedingungen war häufig gerade für die Frauen das, was ihnen die Überwindung der geschlechtsbedingten Diskriminierungen erlaubte: Eine Vielzahl von Lehrerinnen, von Gründerinnen und Leiterinnen sozialer Werke, von Revolutionärinnen, Ärztinnen, Schriftstellerinnen, Denkerinnen etc. mag dies deutlich machen;
(4) schliesslich in einem spezifischen Verhältnis zur Zeit, das, messianisch bestimmt, immer zugleich auf den „Uranfang“ und auf die Zukunft gerichtet ist und in dieser Bestimmung, gemäss Hermann Cohen, den „tragischen Begriff“ des jüdischen Menschen schafft, das jedoch zugleich dem Leiden Israels in der Verbannung (seit den Propheten, in jüngerer Zeit erneut seit der lurianischen Kabbala) Sinn gibt. Seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam zur religiös definierten Ausrichtung auf die Zukunft zusätzlich die säkulare Sinndimension des Zionismus hinzu, der auch eine Art säkularer Glückserwartung[1] einschloss. Während die messianische Zeitdimension weiterbestehen bleibt, ist die zionistische seit der Konstitution des Staates Israel gewissermassen zur postzionistischen geworden. Mag sein, dass die Zeit-Theorien, die wir bei Henri Bergson, Albert Einstein, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Margarete Susman und bei anderen jüdischen Denkern und Denkerinnen finden, ihren Ursprung im spezifisch jüdischen Verhältnis zur Zeit haben. Hannah Arendts Verständnis der Natalität, eines Kernbegriffs ihrer Philosophie, ist eigentlich nur aus der Bedeutung des jüdischen Zeitverhätnisses heraus zu verstehen. In der Natalität, die der Moratlität entgegensteht, ist die Freiheit eines jeden Menschen begründet, die Möglilchkeit zum Neubeginn, allein auf Grund der Tatsache, dass er geboren wurde. So ist die Freiheit des Menschen, sein höchstes Gut, immer von neuem das Geschenk einer Frau an ihr Kind.
Ich denke, dass in der Weitergabe und Vermittlung der Kenntnis dieser vierfachen Verhältnishaftigkeit in ihrer religiösen, existentiellen und weltlichen Komplementarietät Tradition zu verstehen ist. So ist es, resp. sollte es eigentlich einleuchtend und klar sein, dass Tradition und persönliche Weiterentwicklung einerseits, Tradition und gesellschaftlicher Fortschritt andererseits sich nicht ausschliessen, auch nicht bei Frauen. Doch so klar war dies und ist dies keineswegs. Was die Moderne bewirkt hat – die rechtliche Emanzipation und politische Gleichberechtigung der Juden als Volk (allerdings noch nicht der Frauen), damit die Möglichkeit der freien Berufsausübung und der freien Wohnsitzwahl, damit die Teilhabe an den politischen und gesellschaftlichen Prozessen und Entscheiden des Landes, in welchem man lebte, d.h. die aktive Mitgestaltung der Veränderung nicht nur der persönlichen Lebensbedingungen, sondern zugleich der gesamtgesellschaftlichen, damit die Aufarbeitung und Überwindung autoritärer Unterwerfungsclichés in allen Bereichen, die Abstützung nicht mehr auf religiöse oder andere Autoritäten, sondern auf die alleinige Selbstverantwortung im Urteilen und Handeln, resp. in der Gestaltung des eigenen Lebens, die ausschliesslichen Rechenschafspflicht dem eigenen Gewissen gegenüber – all dies steht der Herkunftsbindung, der Bindung an das Judentum, eigentlich nicht entgegen. Mendelssohns Vorbild in der furchtlosen Verbindung von gläubiger Tradition und Freiheit des Denkens war Baruch de Spinoza (geb. 1632 in Amsterdam, gest. 1677 in Den Haag), der grosse jüdische Philosoph, der mehr als ein Jahrhundert früher schon auf dem Selbstverständnis, letztlich auf der Ethik des eigenen Denkens, der selbstverantworteten Meinungsäusserung und Lebensführung bestand, auch gegen den Unterwerfungsanspruch seiner jüdischen Gemeinde, die über ihn den cherem sprach, weil er den Erkenntnisprozess seines philosophischen Werkes selber verantworten wollte.
Glückel von Hameln, von der zuerst die Rede sein soll, 1645 geboren, war eine Frau aus der Generation Spinozas. Sie versuchte, Tradition und selbst bestimmtes Leben zu vereinbaren, obwohl die Bedingungen hierfür schwierig waren. Sie lebte im jüdischen Ghetto von Hamburg, wo im 17. Jahrhundert die Judenfeindlichkeit grassierte, wo aber einige jüdische Familien geduldet wurden, wenn sie der Stadt das geforderte „Schutzgeld“ zahlten, vor allem Händler, die mir ihren internationalen Beziehungen der Stadt Vorteile brachten.
Im Jahre 1691, mit 46 Jahren, begann Glückel, Tochter des Hamburger Diamantenhändlers Löb Pinkerle, ihre „Sichronoth“, ihre Erinnerungen für ihre „herzlieben Kinder“ aufzuschreiben, „dass (damit) ich nicht, Gott bewahr, in melancholische Gedanken sollte kommen“, wie sie festhielt. Denn zwei Jahre vorher war ihr Mann Chaijm (der) von Hameln (kam) gestorben. Sie nannte ihn ihren „lieben Freund“ und ihren „Tröster“. Während der dreissig Jahre ihrer Ehe hatte sie ihm nicht nur zwölf Kinder geboren, sondern hatte ihm auch geholfen, einen florierenden Handel aufzubauen. Sie schreibt von ihm, er sei „wacker“ und „hilfreich“ gewesen, die „reine Güte“, und er habe sie „wie seinen Augapfel gehütet“. Auf dem Sterbebett hatte Chaijm dem Rabbi klargemacht, dass Glückel nach seinem Tod keines männlichen Vormunds bedurfte: “Meine Frau, die weiss von allem. Lasst sie tun, wie sie vordem zu tun gepflegt”.
So wurde Glückel zur selbständigen Händlerin und Geldleiherin – wohl eine der ersten Frauen überhaupt, von denen wir genaue Kenntnis haben (dank ihrer eigenen Aufzeichnungen), die allein und ohne männliche Hilfe ihr Geschäft führten. Einen der Söhne, Löb, dem nichts gelang, der sich im Gegenteil immer wieder verschuldete, behielt sie bei sich, damit er nicht noch seine Geschwister in die Armut treibe, wie sie festhielt. Glückel war noch erfolgreicher als ihr verstorbener Ehemann, eine tüchtige Geldverleiherin, sie fuhr sogar ins Ausland auf Messen, sie hatte eine Strumpffabrik und ein eigenes Gewölbe zur Lagerung der Waren. Gleichzeitig sorgte sie dafür, dass alle ihre Kinder, auch die Töchter, lesen, schreiben und rechnen lernten wie sie selbst. Nachts hielt sie im spezifischen Jüdisch-Deutsch jener Zeit, in hebräischen Lettern, fest, was sie, zum Teil noch zu Lebzeiten ihres Mannes, erlebt und entschieden hatte, aber auch was sie sich überlegte und was sie ihren Kindern an Wissen weiterzugeben wünschte: Betrachtungen zum Zeitgeschehen, zu eigenen Geschäften und zu jenen von Verwandten und Bekannten, zu Abschnitten aus der Bibel und zu Legenden, auch die Geschichte ihrer Familie.
Damit entstand nicht nur ein persönlicher Zeitspiegel, sondern das spannende Zeugnis einer unerschrockenen Verbindung von frommem, gottesfürchtigem Leben und weiblicher Selbstbestimmung, und zugleich eine wichtige Dokumentationsquelle für das damalige jüdische Leben in den norddeutschen Städten. So schrieb sie, zum Beispiel: „Wir haben in Hamburg kein Bethaus gehabt und auch gar kein Wohnrecht. Nur aus Gnade vor dem Rat – Gott erhöhe seinen Ruhm, sind sie dort gewesen. Doch snd die Juden zusammengekommen in ihren „Wohnungen zum Beten, so gut sie nebbich gekonnt haben. Wenn solches die Räte der Stadt vielleicht schon gewust haben, haben sie doch gern durch die Finger gesehen. Aber als es Geistliche gewahr worden sind, haben sie es nicht leiden wollen und uns nebbich verjagt, und wie das schöchterne Schaf“…
Glückel starb mit fast achtzig Jahren bei ihrer Tochter Esther. Sie war in Frieden alt geworden, es ging ihr gut, bis auf eine Enttäuschung: nach elf Jahren – man könnt sagen – erfolgreicher Witwenschaft hatte sie wieder geheiratet, einen damals angesehenen Bankier. Doch der Bankier ging pleite und starb, und sie, die ihr ganzes Vermögen vertrauensvoll in dessen Geschäft eingebracht hatte, war zum Schluss allein noch auf die Fürsorge ihrer „herzenslieben Kinder“ angewiesen.
Ihre fünf Bücher wurden erstmals 1896 veröffentlicht. Herausgeber war damals David Kaufmann, ein Lehrer an der Landesrabbinerschule Budapest, dessen Ehefrau weitläufig mit Glückel von Hameln verwandt war. Diese hebräisch gedruckte Ausgabe von Glückel von Hamelns Werk wäre vermutlich kaum beachtet geblieben, wenn sie nicht ins Deutsche übertragen und neu herausgegeben worden wäre, 1910, wiederum durch eine bedeutende Frau, eine der bedeutenden bürgerlichen Feministinnen, die zugleich eine ihres Judentums bewusste Jüdin und ebenfalls eine entfernte Verwandte Glückels von Hameln war: Bertha Pappenheim.
Bevor ich jedoch auf Bertha Pappenheim eingehe, möchte ich doch kurz festhalten, dass es in der Nachfolge Glückels von Hameln einige bedeutende jüdische Geschäftsfrauen gab, ja dass viele jüdische Frauen sich um Haushalt und Lebensunterhalt kümmern mussten, nicht zuletzt infolge der Tatsache, dass viele jüdische Männer sich auf das Thorastudium und den Austausch unter Gelehrten zurückzogen. Eine unter ihnen, ein knappes Jahrhundert nach Glückel, war zum Beispiel Chaile (Karoline) Raphael Kaulla, 1739 in Buchau (Oberschwaben) geboren, aus einer wohlhabenden, den Gedanken der Aufklärung gegenüber aufgeschlossenen Familie, in der sie eine sorgfältige jüdische Erzeihung genoss, aber auch in Deutsch unterrichtet wurde. Nachdem sie mit 18 Jahren Akiba Auerbach geheiratet hatte und eine Schar Kinder auf die Welt setzte, sah sie ein, dass sie für diese auch zu sorgen hatte, da ihr Ehemann sich ganz dem religiösen Studium widmete. So führte sie zusammen mit ihrem Bruder das Handelshaus Kaulla, vertrat dieses als Chefin gegenüber Landesfürsten und Geschäftspartnenr, weitete es vom Pferde- und Warenhandel zum Bankhaus aus, wurde Königlich Würtembergische Hofbanquière und erhielt schliesslich 1807, zwei Jahre vor ihrem Tod, vom Haus Habsburg die „grosse goldene Ehrenkette mit Medaille“. Immer blieb sie dabei eine fromme Jüdin, gesetzestreu und wohltätig; mit ihrem Vermögen stiftete sie unter anderem eine Talmudschule in Hechingen und unterstützte zahlreiche karitative Einrichtungen. Die Bank Kaulla bestand bis 1924, als sie im Lauf der grossen Depression in der Deutschen Bank aufging.
So ergaben sich über die wirtschaftliche Tätigkeit erste Ausbruchsmöglichkeiten, über Bildung und rechtliche Emanzipation, über die Literatur, das Schreiben, das geistvolle Gespräch in den Salons nächste weitere. Ich werde nun auf die Rahel Levin, 1771 in Berlin geboren, nach der Heirat mit Karl August Varnhagen im Jahre 1814 Rahel Varnhagen, ist eine der repräsentativsten und zugleich berührendsten Frauengestalten dieser Zeit, eine unermüdliche und unvergleichliche Briefeschreiberin, welthungrig, liebeshungrig, ungemein freundschafts- und sprachfähig, von „leidenschaftlicher Ursprünglichkeit und ausserordentllicher Klugheit“, wie Hannah Arendt schrieb, die ihr eine nahe, mitempfindende Studie gewidmet hat. Nachdem Rahel mit dem – nicht ablegbaren – Unglück ihrer „infamen Geburt“, wie sie schrieb, als Frau, als Jüdin, „nicht hübsch, ignorant, ohne grâce, sans talents et sans instruction, ah, ma soeur, c’est fini“ und „man ist arm“, wie sie hinzufügte, nachdem sie diesem Unglück, den vielen Enttäuschungen in der Liebe, den Zurückstellungen, Verlassenheiten und immer wieder betrogenen Sehnsüchten standgehalten hat, sich mit 43 Jahren taufen liess und gleichzeitig gegen jede Anpassung aufbegehrte, in den damaligen Weltstädten Berlin, Paris, Wien und Prag und in vielen kleineren Städten mit Prinzen, Fürsten, mit ihren Geschwistern, mit Freundinnen, mit Dichtern und Denkern alle Fragen der Existenz, des gesellschaftlichen Laufs und des Weltgeschehens abgehandelt hat, muss dieselbe Rahel 1833, im Alter von 63 Jahren, kurz vor dem Tod, gemäss den Aufzeichnungen ihres Ehemanns, gesagt haben: „Welche Geschichte! Eine aus Ägypten und Palästina Geflüchtete bin ich hier und finde Hilfe, Liebe und Pflege von euch! Mit erhabenem Entzücken denk‘ ich an diesen meinen Ursprung und diesen ganzen Zusammenhang des Geschicks, durch welche die ältesten Erinnerungen des Menschengeschlechtsmit der neuesten Lage der Dinge, die weitesten Zeit- und Raumfernen verbunden sind. Was so lange Zeit meines Lebens mir die grösste Schmach, das herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sei, um keinen Preis möchte‘ ich das jetzt missen.“ So hat Rahel – die lange schmerzlich verweigerte – Tradition mit der Moderne zusammengebracht, wenngleich in deren prekärsten, fragilsten Ausformulierung.
Im Gegensatz zur jungen Rahel Levin oder Brendel Mendelssohn empfand Henriette Herz das Jüdischsein und Frausein nicht als Schmach. Trotzdem liess auch sie sich 1817, ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter, mit 53 Jahren, taufen. Die von ihr verfassten Erinnerungen und literarischen Portraits ihrer Freundinnen und Freunde sind von grosser, zugleich knapper Präsision, eine seltene Quelle des Wissens über die damalige, in geistiger und politischer Hinsicht so unruhigen Zeit.
1847 starb Henriette Herz in Berlin. Während die jüdischen Frauen der Romantik das Bedürfnis nach Veränderung an sich selbst vollzogen, richtete die nächstfolgende Generation, aus der ich Ihnen eine-zwei bedeutende Frauen, stellvertretend für die zahlreichen anderen, vorstellen möchte, den emanzipatorischen Elan nicht mehr nur auf sich und das eigene Leben, sondern zugleich nach aussen, auf die, auch innerjüdischen, sozialen und politischen Verhältnisse.
Zu dieser Generation gehört Bertha Pappenheim. Sie wurde 1859 in Wien geboren und wuchs in einer orthodoxen, aber weltoffenen Familie auf. Als sie die “Memoiren der Glückel von Hameln” 1910 publizierte, war sie 51 Jahre alt. Sie lebte und wirkte als unverheiratete Frau in Frankfurt, als – damals schon berühmte – Exponentin jüdischer Sozialarbeit und Mädchenerziehung, Vorsitzende des von ihr gegründeten Jüdischen Frauenbundes, der 50’000 Mitglieder zählte, sie war Verfasserin von Romanen, Geschichten und Gedichten (unter dem Pseudonym Paul Berthold), von sozialpädagogischen und gesellschaftskritischen Aufsätzen (vor allem in den „Blättern des Jüdischen Frauenbunds“, des JFB, den sie 1904 gegründet hatte), eine Reisende in die Länder der Armut und des Aufbruchs – nach Russland und Polen sowie in das damalige Palästina. Sie kämpfte gegen die Probleme des Mädchenhandels und der Prostitution armer jüdischer Frauen, gründete in Frankfurt das „Isenheimer Erziehungsheim“, das sie mit grosser Strenge führte (sie verfasst eigene Gebete für ihre Zöglinge, welche Margarete Susman herausgegeben und kommentiert hat). Auf Bertha Pappenheims Anregung geht auch die Gründung der damaligen „Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden“ zurück, sie arbeitete eng mit Jenny Apolant zusammen, der Schwester Walter Rathenaus, welche ab 1907 den Aufbau und die Leitung der „Zentral- und Auskunftsstelle der Gemeindämter für die Frau“ übernahm.
Mit ihrer vielseitigen Tätigkeit versuchte Bertha Pappenheim einerseits, ihr Bedürfnis nach Mütterlichkeit zu stillen, das in biologischer Hinsicht unerfüllt geblieben war, andererseits einen Mangel jüdischer Mädchenerziehung wettzumachen, unter dem sie selber so sehr gelitten hatte, dass sie als junge Frau aufs schwerste seelisch erkrankt war: den Mangel, als Frau nicht studieren zu dürfen, sich nicht auf einen Platz auch im öffentlichen Leben vorbereiten zu können, sondern nur für ein aufopferndes Leben in der eigenen Familie vorgesehen zu sein. Indem sie krank wurde, entzog sie sich der Ehe. Berta Pappenheim war die “Anna O.”, die der Wiener Nervenarzt Josef Breuer behandelt und und deren Krankheits- und Heilungsgeschichte durch Sigmund Freund als der Anfang, ja als die Erfindung der Psychoanalyse geschildert wurde. Ihre ganze schöpferische Energie, ihre Tatkraft verlegte sie auf die Sozialarbeit, auf die Erziehung und „Rettung“ gefährdeter jüdischer Mädchen aus armen und ärmsten Verhältnissen. 1930 veröffentlichte sie den Band „Sisyphus-Arbeit“ mit ihren wichtigsten Recherchen, und öffentlichen Reden. Sie starb 1936 an Krebs, nachdem sie zuvor noch von der Gestapo zum Verhör vorgeladen worden war. Die Kinder und Betreuerinnen des von ihr gegründeten “Isenburger Heims”, auch Bertha Pappenheims engste Mitarbeiterin und Nachfolgerin Hannah Karminski, wurden 1942 nach Theresienstadt und später in die Vernichtungslager deportiert.
Neben der Sozialarbeit, in der nicht nur Bertha Pappenheim, sondern viele jüdische Frauen sowohl in den Gemeinden wie über diese hinaus in allen Bereichen der Gesellschaft ihre schöpferische Energie und ihre menschliche Verlässlichkeit in den Dienst von Schwächeren – von Kindern, von armen, kranken, einsamen und alten Menschen stellten, müssen die politischen Gesellschaftskämpferinnen erwähnt werden, ob sie sich als Sozialistinnen, Gewerkschafterinnen, Kommunistinnen und/oder Zionistinnen verstanden. Als eine unter vielen bedeutenden Frauen will ich die viel zu wenig gewürdigte Alice Rühle-Gerstel vorstellen.
Alice Rühle-Gerstel, 1894 in Prag geboren, hatte Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, 1921 über Friederich Schlegels Aphorismen (s. Dorothea Schlegel) promoviert, heiratete Otto Rühle, der an einer Synthese von Marxismus und Individualpsychologie arbeitete, wurde selber Adler’sche Psychoanalytikerin und Verfasserin zahlreicher Schriften, bis sie als Jüdin und Marxistin durch die nationalsozialistische Verfolgung nach Mexiko ins Exil gezwungen wurde, gemeinsam mit ihrem Mann, mit dem sie die Schriftenreihe “Am anderen Ufer – Blätter für sozialistische Erziehung” und die Monatszeitschrift “Das proletarische Kind” herausgeben hatte.
Sie befasste sich in der Zwischenkriegszeit[2] insbesondere mit den Gründen der Diskriminierungen der Arbeiterinnen. Warum die Forderung “Gleicher Lohn für gleiche Arbeit” keine Chance hatte, durchgesetzt zu werden. Sie kam dabei zu einem Schluss, der erstaunlcih klingt: “Der Arbeiter war durch die Neuordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse gezwungen, seine Frau und Tochter in die Fabrik zu schicken, weil das eigene Einkommen zum Unterhalt der Familie nicht zulangte, oder, wie bei den Hauswebern, auch völlig versiegte. In der Fabrik aber trat der Arbeiter der Frau und Tochter seines Kameraden mit Misstrauen gegenüber als einer Lohndrückerin und Arbeitsstehlerin. Darum erscholl von Seiten der Arbeiter alsbald die Parole: Frauen raus aus der Fabrik! Solange aber die Frauen billiger arbeiten, bleibt diese Parole dem Unternehmer gegenüber wirkungslos. Der Lohnausgleich kann, wenn er erreicht wird, nicht durch einen Lohnzuwachs der Frauen herbeigeführt werden, sondern nur durch eine Lohnkürzung der Männer, bestenfalls durch einen Kompromiss zwischen diesen beiden Strebungen. Deshalb lehnten breite Kreise der Arbeiterschaft die freiheitliche Forderung ‘Gleicher Lohn für gleiche Arbeit’ lange Zeit hindurch ab. (…) Auf dem Arbeitsmarkt behandeln die Männer die Frauen wie fremde Einwanderer”.[3]
Dass es um die Lohnbedingungen der ausländischen Arbeiterinnen, der tatsächlichen “Einwandererinnen”, vergleichsweise noch schlechter bestellt war (und weiterhin ist), liegt, Alice Rühle-Gerstel zufolge, in der Tatsache nicht nur der männlichen, sondern zusätzlich der weiblichen einheimischen Rivalisierungsangst und Desolidarisierung. Gerade für die Ausländerinnen gilt, was Alice Rühle-Gerstel zu ihrer Zeit für die Arbeiterinnen generell festgestellt hat: “Sie teilen nicht nur das proletarische Schicksal der Männer, sondern müssen es in doppelter Schwere ertragen. Die Industriearbeit der Frau ist Mussarbeit im schärfsten Sinn. Sie ist schlecht entlöhnt, sie stellt durch die räumliche und zeitliche Trennung von Berufsleben und Privatleben die Frau vor besondere Probleme. Sie bietet keine Aufstiegsmöglichkeit und wird gering gewertet. Die Unkollegialität der Männer, die Gegensätze zwischen Alten und Jungen, Verheirateten und Unverheirateten verschlechtern die Situation der Arbeiterin. Das Bewusstsein ihres Schicksals ist entweder überhaupt nicht vorhanden oder von Groll und Zorn, Hoffnungslosigkeit und Angst entstellt. So stellt sich die Beziehung der Arbeiterin zu ihrer Arbeit dar als eine müde, mutlose Resignation gegenüber einem verhärteten Schicksal”[4].
Nach dem Tod des Ehemannes nahm Alice Rühle-Gerstel sich 1943 im mexikanischen Exil das Leben.
So wie ich mit Alice Rühle-Gerstel eine beinah Unbekannte gewählt habe – neben Berühmtheiten, die vorzustellen wären, die ich ebenfalls bewundere, wie Rosa Luxemburg, Luise Kautski, Rosa Grimm und weitere Frauen in der Zeit zwischen revolutionärem Aufbruch und nationalsozialistischem Verhängnis –, so will ich noch auf zwei weitere ungewöhnliche, aber wenig bekannte Frauen hinweisen, die selbständig und bewusst ihren eigenen Weg zwischen Tradition und Moderne gingen: auf Alis Guggenheim im Bereich der Kunst und auf Regian Jonas, welche die erste, und bis in die siebziger Jahre einzige ordinierte Rabbinerin war. Mit der Philosophin Hannah Arendt werde ich meine Frauenportraits und meine Überlegungen zu ihrem oft so schwierigen Weg zwischen Judentum und einem Platz in der Welt abschliessen.
Während ihres Lebens wurde Alis Gugenheim selten viel Anerkennung zuteil. 1954 erhielt die damals 58jährige Künstlerin den Kunstpreis für darstellende Kunst des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) und im gleichen Jahr gewährte ihr Zürich erstmals eine grosse Einzelausstellung in der städtischen Galerie “Zum Strauhof”, an der sie so gut verkaufen konnte, dass sie plante, eine Weltreise zu machen, per Ozeandampfer nach Neuseeland und Australien zu fahren, auf dem Rückweg in Israel Halt zu machen und überall unterwegs Freundinnen und Freunde zu besuchen und zu malen. Den Plan konnte sie nicht mehr realisieren, sie wurde schwer krank und starb 1958 in Zürich.
Tagebuchaufzeichnungen, Notizen auf losen Zetteln, Gedichte und in Briefe halten ihr Leben fest. 1896 war sie in Lengnau als drittes von sieben Kindern zur Welt gekommen, in einer armen, frommen jüdischen Familie, die später nach Dielsdorf und schliesslich nach Zürich zog. Alis hatte ein Welschlandjahr absolviert, eine Lehre als Modistin gemacht, einen eigenen Salon eröffnet und geführt – doch dann kam alles anders: die Liebe zum fremden Mann, dem sie in Zürich auf der Strasse begegnete, zu Mischa Berson, einem verheirateten Arzt, der sich gleicheztig mit Lenin in Zürich im Exil befand, dem sie 1917 nach Moskau folgte, die Kommunistische Revolution, Moskau, das Kind Mischa Bersons, das in Moskau zur Welt brachte, von ihrer Liebe alleingelassen, in all ihren Hoffnungen alleingelassen, dann mit dem Kind nach einigen Monaten nach Zürich zurück, Anfang Zwanzigerjahre ein Sakndal, für sie ein Stolz und ein hartes leben. Allein zog sie es auf, ohne Vormund, obwohl sie, die Mutter, nie ein regelmässiges Einkommen vorweisen konnte, dann der Weg in die Kunst, Skulpturen gestalten, malen, ein längerer Aufenthalt in Paris, das Alleinsein, die Ausgrenzung durch die bürgerliche Gesellschaft, der eigene Weg, die späteren Jahre in Muzzano, im Tessin, ein schweres Krebsleiden und der Tod 1958 in Zürich. Ein glühendes und generöses, bescheidenes, für die damalige Zeit ungewöhnliches und furchtloses Leben – das Leben einer schweizerischen Jüdin und Kommunistin, einer eigenwilligen und begabten Künstlerin.
Auch von diesem Leben haben wir Kenntnis dank ihrer eigenen Aufzeichnungen. Alis Guggenheim begann mit Tagebuchnotizen am Tag nach ihrem 18. Geburtstag, und bis kurz vor ihrem Tod hielt sie in irgend einer Form fest, was ihr wichtig erschien, vor allem, was ihr schwer ertragbar erschien. Indem sie dies tat, indem sie schreibend für die existentiellen Widrigkeiten, für die Enttäuschungen und Sorgen, aber auch für die grossen Begeisterungen eine sprachliche Form fand, entlastete sie ihre künstlerische Arbeit davon. So gelang es ihr, in den Plastiken, Malereien und Keramiken nur demjenigen Ausdruck zu geben, dem sie zustimmen konnte: der Natur, der menschlichen Gestalt, dem liebenden Verhältnis von Menschen, dann, in der letzten Schaffensphase, den Erinnerungen an die dörfliche, von den jüdischen Familienfesten geprägte Kindheit. Alis Guggenheims Schreiben hatte somit keinen – primär – literarischen Zweck, sondern entsprach einem Bedürfnis nach Realitätsverarbeitung, das sie erfüllen musste, um überhaupt schöpferisch arbeiten zu können. Darin findet sich der Satz, den sie vermutlich als Erklärung und Rechtfertigung ihres Lebens verstand, der mir zum Schlüssel für ihr Werk wurde: “Ich habe ein Herz gehabt, das immer die Liebe suchte und wollte”.
Ein glühendes Leben ganz anderer Art war dasjenige von Regina Jonas. Sie kam 1902 in Berlin zur Welt, und ihren Weg zur Rabbinerin ging sie ganz gerade. Nach dem Abschluss des Gymnasiums besuchte sie während sechs Jahren, von 1924 bis 1930 die Hochschule für Wissenschaft des Judentums in Berlin. Ihre religionsgesetzliche Prüfungsarbeit betraf die Frage ihres eigenen Wegs: „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“ Ein damals berühmtr Talmudprofessor, Eduard Baneth, schrieb als Schlussfolgerung seiner Begutachtung: „Ausser Vorurteil und Ungewohntsein steht halachisch fast nichts dem Bekleiden des rabbinischen Amts durch eine Frau entgegen“. Schliesslich wurde Regina Jonas 1935 das Rabbintasdiplom ausgehändigt und bescheinigt, dass sie nicht nur fähig, sondern auch geeignet sei, das rabbinische Amt zu bekleiden. Die Frage der Anstellung war schwieriger. Zuerst unterrichtete sie einfach Religionslehre, ab 1937 wurde sie von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin offiziell ins Beamtenverhältnis aufgenommen, mit dem Auftrag, „rabbinisch-seelsorgerische Betreuung in den Sozialanstalten der Gemeinde auszuüben“. Sie war eine gesuchte Vortragsrednerin, sie sprach häufig zur Stellung der jüdischen Frau. Ab 1938 vertrat sie zunehmend Gemeinderabbiner, die ausgewandert oder deportiert worden waren, und zu diesem Zweck reiste sie quer durch Deutschland. Sie wurde zur Zwangsarbeit in einer Berliner Kartonagefabrik verpflichtet, setzte aber ihre rabbinische Tätigkeit bis 1942 fort, als auch sie verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde, zusammen mit ihrer Mutter. Auch dort war sie als Seelsorgerin tätig, hielt Vorträge und unterstützte Victor Frankl in seiner Tätigkeit. Am 12. Dezember 1944 wurde Regina Jonas nach Auschwitz deportiert, von wo sie nicht mehr zurückkehrte.
Im Theresienstädter Archiv findet sich eine Notiz zu einer Predigt: „Unser jüdisches Volk ist von Gott in die Geschichte gesandt worden als ein ‚gesegnetes Volk‘. Von Gott ‚gesegnet‘ sein heisst, wohin man tritt, in jeder Lebenslage, Segen, Güte, Treue spenden. Demut vor Gott, selbstlose, hingebungsvolle Liebe zu seinen Geschöpfen erhalten die Welt. Diese Grundpfeiler der Welt zu errichten war und ist Israels Aufgabe. Mann und Frau, Frau und Mann haben diese Pflicht in gleicher Treue übernommen. Diesem Ideal dient auch unsere ernste, prüfungsreiche Theresienstädter Arbeit. Diener Gottes zu sein, als solche rücken wir aus irdischen in ewige Sphären.“
Die Frage, was die Welt erhält, was sie vor der totalen Destruktivität schützt, stellte sich nicht die Rabbinerin. Diese Frage stand auch für Hannah Arendt im Mittelpunkt ihrer philosophischen Arbeit, bei der sie die grossen Theorien der antiken griechischen Denker, Augustins (über dessen Liebesbegriff sie doktorierte), Kants sowie wichtiger Theoretiker der politischen Theorie benutzte, um die Geschichte des Zusammenlebens der Menschen zu verstehen, die Geschichte der Macht und des Machtmissbrauchs, der Ideologien, insbesondere des Antisemitismus, der zu einem konstituierenden Teil des Nationalsozialismus wurde, sodann der Herrschaftsformen des Imperialismus und des Totalitarismus überhaupt in seinen all seinen menschenverachtenden Elementen und Folgen.
Hannah Arendt wurde 1906 in Hannover geboren, zog mit den Eltern nach Königsberg, wo der Vater 1913, als Hannah sieben jahre zählte, nach einer schweren Krankheit starb, einige Monate vorher im selben Jahr auch der Grossvater väterlicherseits. Sie wuchs bis in die frühe Adoleszenz allein mit ihrer Mutter auf, die aus einem angesehenen Königberger Haus stammte und die selber furchtlos und engagiert war, Mitglied der damals verbotenen sozialistischen Partei wie auch der verstorbene Vater. Sie prägte ihrer Tochter ein, sich nie zu ducken, und sie ermöglichte ihr, ganz ihren Bedürfnissen entsprechend zu lernen, sich zu bilden und Freundschaften zu pflegen. Hannah Arendt studierte Theologie, Philosophie und Griechisch, und ihre Lehrer wurden für sie lebensbestimmend, wohl auch stellvertretend für die früh verstorbenen Vaterfiguren: Rabbi Vogelmann, der ihr, als sie Kind war, Religionsunterricht erteilte, Kurt Blumenfeld, der deutsche Zionistenführer, mit dem sie ebenfalls seit der Kindheit eine fast lebenslängliche Freundschaft verband, später Martin Heidegger, mit dem sie sich als 18jährige Studentin in eine passionelle Liebesgeschichte verstrickte, die sie eigentlich ihr ganzes Leben nie aufgab, Karl Jaspers, von dem sie sagte, er habe sie „erzogen“. Auch ihr zweiter Ehemann, der ehemalige Berliner Spartakist Heinrich Blücher, in den sie sich 1936, im Exil in Paris, verliebte, war zugleich Lehrer, Geliebter und Freund nachdem sie und Günther Stern (Günther Anders), mit dem sie in erster Ehe verheiratet war, sich schon sehr von einander distanziert hatten (wenngleich sie ein Leben lang in Freundschaft verbunden blieben). Für sie galt, was sie einmal schrieb: „Treue ist das Zeichen der Wahrheit“. Beziehungen zwischen Menschen dürfen nicht einfach gelöst, in Frage gestellt oder gar zerstört werden, denn das Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen ist das, was Welt, Welthaftigkeit bedeutet. Das „Anwachsen der Weltlosigkeit, das Weggleiten des Zwischen (des inter-esse), die Ausbreitung der Wüste in der Welt“ sind die Bedingungen, unter denen wir leben. Dem sich entgegenstellen bedeutet, die persönlichen Beziehungen mit grosser Sorgfalt pflegen. Doch dies genügt nicht. Es braucht ein immer wieder neu beginnendes, über die Sprache und den Austausch sich konstituierendes Handeln, es braucht immer wieder den Rekurs auf die „Natalität“, auf das Prinzip der Freiheit, trotz aller Bedingtheiten, auf die Voraussetzung der Möglichkeit zum Neuanfang. Dabei liegt grösste Freiheit, nach Hannah Arendt, bei den Opfern des vorausgegangenen zerstörerischen, schuldhaften Handelns, da allein die Opfer verzeihen können und dadurch einen Neuanfang möglich machen, für sich selber und für die Täter (oder Täterinnen).
Als Hannah Arendt am 4. 12.1975 in New York an einem Herzversagen starb, da war uns, die wir in ihren Fussstapfen weiterarbeiteten, dass sie für unsere Zeit ein wichtiges Vorbild in der so schwierigen Verbindung von eigenständigem, selbstbejahendem Weg und der ganz klaren Zustimmung zur jüdischen Herkunft, zum Judentum war, einer Zustimmung, die gerade wegen ihrer Klarheit das kritische Auge zuliess.
So bin ich nun – aus Zeitgründen – am Schluss meiner Überlegungen zur jüdischen Frau angelangt, obwohl diese Überlegungen nicht noch Stunden, sondern noch Jahre lang weitergeführt werden könnten, wenn die Vielfalt des gelebten Lebens wirklich aufgearbeitet, verglichen und erzählt werden sollte. Denn mit dem Erzählen schaffen wir zugleich wieder das, was mit Tradition gemeint ist: wir geben weiter und bringen das Vergangene im Augenblick des gemeinsamen Daseins und Handelns, des Sprechens und Zuhörens, zusammen mit dem in der Zukunft erst Möglichen.
[1] „Die Kerle wollen glücklich sein“, wie Franz Rosenzweig Hermann Cohen gegenüber äusserte.
[2] Alice Rühle-Gerstel. Die Frau und der Kapitalismus. Eine psychologische Bilanz. Verlag Neue Kritik, Frankfurt a.M. 1972 (Nachdruck der Erstausgabe von 1932).
[3] Alice Rühle-Gertel, a.a.O.
[4] Alice Rühle-Gerstel, a.a.O.
 Wird geladen …
Wird geladen …
 Wird geladen …
Wird geladen …
 Wird geladen …
Wird geladen …
 Wird geladen …
Wird geladen …








