Braucht es einen feministischen Katalog der Grundbedürfnisse? – Über Bedürfnisinterpretation, Machtteilhabe und eine neue Zeitökonomie
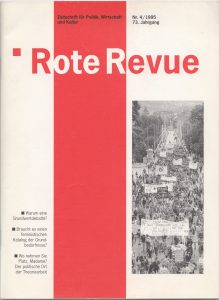 Magazinbeitrag für:Rote Revue – Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur Nr 4, 1995
Magazinbeitrag für:Rote Revue – Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur Nr 4, 1995
 Wird geladen …
Wird geladen …
Braucht es einen feministischen Katalog der Grundbedürfnisse?
Über Bedürfnisinterpretation, Machtteilhabe und eine neue Zeitökonomie
In allen Bereichen, in denen Frauen politische Verantwortung übernehmen, formieren sich in zunehmendem Mass Verhinderungsversuche gegen emanzipatorische Veränderungen, das heisst gegen Veränderungen, die aus der patriarchalen “mancipatio”, aus der patriarchalen Verfügungs- und Interpretationsmacht zu mehr Freiheit und zu mehr Eigenbestimmung, damit zu mehr personaler Würde und damit zu mehr Lebensqualität herausführen sollen. Diese Verhinderungsversuche konzentrieren sich meiner Ansicht nach auf drei grundsätzliche Zusammenhänge, die in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit analysiert werden müssen, damit Veränderungen erreicht werden, nicht im “utopos”, nicht im “nirgendwo” einer fernen Zukunft und nicht allein in unseren Phantasien, sondern – von der Vorstellung einer lebenswerten Zukunft her – in unserer unmittelbaren Gegenwart, in unserer politischen und gesellschaftlichen Praxis.
Bei den drei Zusammenhängen, geht es um Verteilungsprobleme, hinter denen Grundbedürfnisse und Grundrechtsprobleme stehen. Es geht
(1) um die Frage der Bedürfnisinterpretation und um die Verteilung der öffentlichen Finanzen,
(2) um die Definition von Macht und um die Verteilung von Macht,
(3) um das Menschenbild sowie um die Definition und Zuteilung des Werts der Zeit.
(1) Die Frage der Bedürfnisinterpretation und die Verteilung der öffentlichen Finanzen Die Philosophin Hannah Arendt hat in ihrem 1958 erstmals erschienenen Werk “Vita activa” die beiden Bereiche menschlicher Organisation – den politischen und den gesellschaftlichen – klar geschieden. Die Merkmale, die sie für die Unterscheidung herausarbeitet, sind im wesentlichen seit der Antike die gleichen: die “polis”, der Bereich des politischen Entscheidens und Handelns, ist gekennzeichnet durch Freiheit, durch gleiche Rechte und durch Sprachbefähigung, ursprünglich – und bis in die jüngste Zeit – ein Bereich, der ausschliesslich den Männern zustand. Daran hatten auch die grossen Revolutionen nichts geändert: von “liberté, égalité, fraternité” waren die Frauen ausgeschlossen, und erst recht die Kinder und “das Gesinde” (damals die Sklaven, heute Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge). Von gleichen Rechten sind diese “Ungleichen” auch heute noch weit entfernt, obwohl die Frauen – das heisst die Staatsbürgerinnen – in der Schweiz seit 25 Jahren über das Stimm- und Wahlrecht verfügen. Doch die formale Rechtsgleichheit ist noch keine Garantie für tatsächlichen Einfluss auf die politischen Verhältnisse. Die Ermächtigung, Rechte auszuüben, genügt nicht. Zusätzlich bedarf es einer spezifischen Selbstermächtigung, welche die Rechte erst wirksam werden lässt: es bedarf der “Sprachfähigkeit”, es bedarf der Fähigkeit, die eigene Stimme, die eigenen Foderungen vernehmbar zu machen und auf nachhaltige Weise mit anderen Stimmen zu verbinden. Den Feministinnen der “ersten Stunde”, die noch keine Rechte hatten, war dies auf vorrangige Weise bewusst, scheint mir, den Pazifistinnen, den Kämpferinnen gegen Armut und gegen Ausbeutung von Kindern und Frauen in den frühkapitalistischen Produktionsprozessen, in der Landwirtschaft und in den privaten Haushalten. Sie haben Rede- und Debattierzirkel eingerichtet, haben das öffentliche Reden geübt und sich gegeseitig dazu ermutigt, und zum Zweck der Veränderung der Misstände haben sie in erster Linie Bildungspostulate formuliert oder selbst Bildungs- und Weiterbildungsstätten insbesondere für Arbeiter und Arbeiterinnen eingerichtet.
Der zweite Bereich dagegen, den Hannah Arendt als den des “oikos” oder des Haushalts bezeichnet, den Bereich des Gesellschaftlichen, war gekennzeichnt durch Notwendigkeit, durch Bedürfnisse und durch Sprachlosigkeit. Es war (oder ist) der Bereich, in dem Frauen, Kinder und “Gesinde” ihren Platz hatten oder noch haben. Was den ersten Bereich auszeichnet – Freiheit und Gleichheit der Stimme -, fehlt hier gänzlich. Hier hat nur jemand eine Stimme: der Haushaltvorstand, der “pater familias”. Dieser hat tatsächlich, nach den jahrhundertelang zementierten Gepflogenheiten der patriarchalen Gesellschaft, das Recht der Bedürfnisdefintion und -interpretation der Familienmitglieder allein nach seinem Gutdünken ausgeübt. Als Mitglied der “polis”, des politischen Gremiums der “Sprachfähigen”, und zugleich als Haupt des “sprachlosen Haushalts”, bestimmte er (oder bestimmt noch immer), was die Frau braucht, was die Kinder brauchen und was “das Gesinde” braucht, immer in Abhängigkeit davon, was er selbst braucht.
In Analogie mit diesem “Familienmodell” bestimmt der Staat oder dessen Funktionäre auf den verschiedenen Ebenen, in welcher Höhe wer welche Sozialleistungen braucht oder nicht braucht, das heisst wem welche Lebensqualität zusteht. Dieses Modell hat bis zu den pervertiertesten Ausformulierungen im totalitären Staat alle Arten von gesellschaftlichen und politischen Realisierungen vorzuweisen, nicht nur in vergangenen Zeiten, sondern auch heute, auch hier in der Schweiz, trotz, ich wiederhole, trotz Frauenstimm- und -wahlrecht und trotz zögerlicher Vertretung der Frauen in eidgenössischen, kantonalen und Gemeindelegislativen und -regierungen. Die reaktionären Kräfte verstehen sehr wohl, worum es geht. Sie versuchen, die in den letzten Jahren erstarkten Stimmen der Frauen im öffentlichen Raum zu übertönen und diejenigen Frauen, die sich zu ihrer “Sprachfähigkeit” bekennen und diese in den Dienst der noch stummeren und rechtloseren Mitglieder der Gesellschaft stellen, zu diffamieren und auszuschalten. Die jüngsten verbalen Attacken auf “die Frauen” im Zusammenhang mit der 10. AHV-Revision (etwa in Nr. 2 von “facts”), die ständige Verunglimpfung der “Feministinnen” durch die Boulevardblätter sind im grösseren Zusammenhang nur einige besonders schrille Töne.
Die Attacken und Verunglimpfungen sollen von massgeblichen Tatsachen ablenken: einerseits von der Tatsache einer zunehmenden Zahl von Sozialhilfeempfängern und -empfängerinnen in unsrem Land (Ende 1993 gesamtschweizerisch rund 180’000 Personen, Ende 1994 schon über 300’000), wobei die – wiederum in starkem Mass systembedingte – Pauperisierung der Frauen und junger Menschen besonders ins Gewicht fällt, andererseits aber von der Tatsache, dass auch heute noch nur dank der unentgeltlichen Leistungen der Frauen im Haushalt, bei der Kindererziehung und bei der Betreuung von kranken und alten Menschen, dank all dieser enormen Leistungen im sogenannt “informellen Sektor”, der laut der Wirtschaftswissenschafterin Mascha Madörin etwa 2,5 % des Bruttosozialprodukts ausmacht, die bürgerlichen Abstriche in der Sozialpolitik nicht zu einem sozialen Notstand führen. Dass nun mit der 10. AHV-Revision dieser sogenannte “informelle Sektor” endlich als rentenberechtigt anerkannt wird, erklärt die giftige rechtsbürgerliche Reaktion, nicht nur in den Angriffen auf die “subversiven” Feministinnen, sondern im handfesten Gegenschlag der Erhöhung des Frauenrentenalters.
Es steht fest, dass, solange Frauen ihre Bedürfnisse nicht selber definieren und interpretieren, diese nach männlichen Eigennutzkriterien bestimmt und ausgelegt werden, ob im Rahmen und Zusammenhang des privaten oder öffentlichen Haushalts. Die Kriterien für die Verteilung und Zweckbestimmung der öffentlichen Finanzen sind dafür Abbild und Konsequenz. Die amerikanische Feministin Nancy Fraser weist dies in ihren (1989 in Amerika, 1994 in Deutschland erschienenen) Untersuchungen für die Verhältnisse in den USA nach (Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht. Edition Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994). Die Ergebnisse ihrer Untersuchung gelten im Prinzip auch für Europa und für die Schweiz.
Doch welches sind die Bedürfnisse der Frauen? Lassen sich diese überhaupt unter einen Nenner bringen, angesichts der enormen Verschiedenheit der Lebensentwürfe und Lebensbedingungen von Frauen, allein schon in der Schweiz, geschweige in Europa (inklusive Ost- und Südosteuropa mit den heute kaum durchschaubaren und für die nächste Zukunft kaum einschätzbaren Destabilisierungen, mit Krieg und mit bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in vielen Ländern), geschweige in den anderen so verschiedenen Kontinenten. Meiner Ansicht nach sollen in erster Hinsicht die unterschiedlichen Bedürfnisse der Frauen in ihrer Besonderheit, das heisst gemäss ihrer spezifischen Priorität, Sprache und Forderung werden. Denn es ist vor allem die Frage der Priorität, welche die Unterschiede ausmacht. Die Bedürfnisse selbst, wie dies auch die Untersuchungen der deutschen Wirtschaftswissenschafterin Susanne Schunter-Kleemann in den meisten europäischen Ländern beweisen (Herrenhaus Europa – Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat, Edition Sigma, Berlin 1992), haben eigentlich ausnahmslos mit Grundrechtsmängeln zu tun, das heisst mit der ungenügenden rechtlichen Anerkennung, Absicherung und Erfüllung der Grundbedürfnisse.
Tatsache ist, dass die universale Erklärung der Grundrechte wertlos ist, wenn diese nicht durch die verfassungsmässigen oder gesetzlichen Garantien der einzelnen Staaten oder transnationaler Verbände einklagbar werden. Solche Garantien kommen jedoch nur durch die Anerkennung der wichtigsten Bedürfnisse als universalen Bedürfnissen zustande. Daher sollten sich die Frauen trotz aller Differenzen in der Prioritätenfrage zu einer gemeinsamen Erklärung ihrer wichtigsten, unverzichtbaren Bedürfnisse einigen, damit, gestützt auf diese Erklärung, in den einzelnen Ländern die Forderungen und Vorstösse der Frauen nach Realisierung und nach öffentlicher Finanzierung ihrer spezifischen Rechtsansprüche mehr Durchsetzungskraft haben.
Ich will diesen Katalog der Grundbedürfnisse nun nicht ausformulieren, sondern nur auf die Vorarbeiten hinweisen, welche die französische Philosophin Simone Weil mit ihrem letzten Werk “L’enracinement” geleistet hat, das sie 1943, kurz vor ihrem Tod im Exil in London vollendet hat und das 1948 durch Albert Camus veröffentlicht wurde. Sie macht darin deutlich, dass Grundbedürfnisse nicht nur die materielle Existenzsicherung betreffen, sondern ebenso sehr geistiger Art sind, dass sie den Hunger nach personalem Respekt, nach Wissen, nach Bildung, nach Freiheit, nach Sicherheit, nach Verantwortung, nach sinnvoller Arbeit, nach Frieden, nach zwangsfreier und demütigungsfreier Einordnung in kollektive Zusammenhänge betreffen, auch den Hunger nach Schönheit. Wenn ich mir zum Beispiel Lebensbedingungen vergegenwärtige, wie ich sie in Flüchtlingslagern gesehen habe, wo die Menschen zwar ein Dach über dem Kopf haben und den Hunger stillen können, wo aber kein bisschen Schönheit, kein bisschen Freiheit, keinerlei sinnvolle Arbeit, kein bisschen Sicherheit ist, weiss ich, in welchem Ausmass Millionen von Erwachsenen und Kindern in der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse auf unerträgliche Weise zu kurz kommen.
Feminismus als emanzipatorisches Projekt heute heisst zuerst Förderung der Sprachfähigkeit, gegenseitige Ermutigung zur Interpretation und Deklaration der eigenen Bedürfnisse sowie der Bedürfnisse der Kinder und der schwächeren, noch sprachloseren Menschen in unserer Gesellschaft, sodann öffentliche und nachhaltige Forderung nach Mitsprache bei der Verteilung der öffentlichen Finanzen, damit das breite Spektrum der Grundbedürfnisse auch der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft erfüllt werden kann.
(2) Die Definition von Macht und die Verteilung von Macht: Ich möchte zuerst wiederum auf die Unterscheidung Hannah Arendts zwischen “polis” und “oikos” zurückkommen. Die Mitglieder der antiken “polis”, weist Hannah Arendt nach, waren in der Lage, ihre gleichen Rechte und Freiheiten zu erhalten, weil sie der Sprache mächtig waren, das heisst der Kunst des Argumentierens, des Überzeugens und Verhandelns, der Bündnisbildung und der Druchsetzung von Entscheiden. Macht, nach Hannah Arendt, ist somit auf direkte Weise verknüpft mit Sprachfähigkeit. Sie bedeutet, ganz direkt, mitreden können im Chor derjenigen, die das Sagen haben. Ich dehne Hannah Arendts Definition noch aus: Macht ist, meine ich, verknüpft mit Kompetenz, nicht nur mit Sprach-, sondern auch mit Sachkompetenz, mit Urteilskompetenz, mit Gerechtigkeitskompetenz, mit menschlicher Kompetenz.
Da während Jahrhunderten Macht zugleich patriarchale Macht bedeutete und immer zugleich Herrschaft, das heisst ein System von Machtmissbrauch implizierte, ist für Generationen von Frauen (und für Generationen von Feminismustheorien) der Machtbegriff negativ besetzt. Macht und Missbrauch von Macht sind jedoch nicht dasselbe. Missbräuche können nur aufgedeckt, benannt und verhindert werden, wenn sie nicht mit Machtausübung selbst verwechselt werden. Wenn Macht als Kompetenz verstanden wird, ist der Begriff positiv zu verstehen. Leider gilt, dass Frauen dem Missbrauch von Macht Vorschub leisten, sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich, solange sie auf einer negativen Defiition und Auslegung des Machtbegriffs beharren. Missbrauch von Macht kann nicht durch Abstinenz von Macht korrigiert werden, sondern allein durch eine andere Art der Machtausübung, durch Macht im Dienst des “bien commun”, des Allgemeinwohls, das sich am Wohl der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft misst.
Es ist dringend, dass Frauen in Bezug auf den Machtbegriff umdenken, dass sie Macht nicht fürchten, dass sie ihren Anspruch auf Macht geltend machen und gewillt sind, Macht auszuüben, zumal Macht, die mit öffentlichen Ämtern in demokratischen Verhältnissen zusammenhängt, immer als Mandat auf befristete Zeit verliehen wird. Zum Mandat gehört auch, dass die Art und Weise der Machtausübung rechenschaftspflichtig ist. Doch da Macht mit Kompetenz verknüpft ist, ist auch diese Rechenschaftspflicht nicht zu fürchten. Vorweg wird ihr durch das Handeln selbst Genüge getan.
Da es darum geht, die Gegenwart von der Zukunft her zu verändern, ist feministische Machtpartiziation dringlich und unaufschiebbar. Konzepte einer lebenswerteren, einer friedlicheren und gerechteren Gesellschaft, in welcher die Differenz von Geschlecht, Alter, Pass und Stand nicht zu einer Differenz von personalem Respekt, von Handlungsmöglichkeiten und Rechten, kurz von Lebensqualität führt, solche Konzepte lassen sich nur verwirklichen, wenn Frauen in den machtausübenden Gremien mitreden, wenn sie selbst Macht ausüben und wenn sie gewillt sind, Bündnisse einzugehen mit jenen Männern, welche die gleichen emanzipatorischen Ziele anstreben. Das heisst zugleich: wenn sie Machtmissbrauch nicht länger dulden, sondern eine andere Art des politischen Handelns vorschlagen und vorleben.
Wie aber sollen Frauen dies lernen, wie sollen sie diese spezifische Befähigung trainieren und erlangen?
Die erste Voraussetzung besteht darin, die Forderung ernst zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse zu prüfen, sie selber zu definieren, zu interpretieren und zu formulieren. Die zweite, den eigenen Widerspruch zu “dem, was ist”, zu ergründen und zu begründen. Die dritte, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen und “laut zu sagen, was ist”, nach einem Wort Rosa Luxemburgs. Die vierte, den Mut, den dieser Schritt in die Öffentlichkeit kostet, nicht zu verlieren, sondern ihn als Motor zu benützen, um die eigene Kompetenz in Hinblick auf eine emanzipatorische Veränderung der Gesellschaft einzusetzen. Immer wieder erinnere ich mich in diesem Zusammenhang jener Frauen, die ohne Theorie und ohne andere Vorbereitung als die gelebte, die erfahrene Unerträglichkeit der Verhältnisse gewagt haben, eine Gegenmacht zu diesen Verhältnissen herzustellen. Unter den vielen will ich nur einige nennen: Olympe de Gouges, die, selbst nicht einmal des Schreibens fähig, die Hintansetzung der Frauen im Bereich der Bildung und der politischen Mitsprachemöglichkeiten nicht ertrug, die der Revolution der Männer von 1789 die Menschenrechtserklärung der Frauen entgegenstellte und dafür mit dem Leben zahlte; Flora Tristan, die im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts als eine der ersten das Bedürfnis und das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung, auf Scheidung und auf Namensgebung der Kinder, kurz, die feministische Postulate mit sozialistischen verband, die die “Union ouvrière” gründete als eine der ersten Selbsthilfemassnahmen der Arbeiterinnen und Arbeiter; Bertha von Suttner, die Friedenkämpferin im Gemetzel des Ersten Weltkriegs; Rosa Luxemburg, die furchtlose Mahnerin gegen die Instrumentalisierung der Menschen in der undustriellen Produktion wie im Krieg; in jüngster Zeit die Frauen in Sizilien, die öffentlich das Gesetz der “omertà” brachen und gegen die Mafia aufstanden, oder die Frauen in Sarajewo, in Belgrad, in Moskau und anderswo, die eine Gegenstimme zur Kriegspropaganda und zur nationalistischen Aufhetzung vernehmen lassen und damit eine moralische Gegenmacht darstellen.
Die Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird, hängt zutiefst mit dem Menschenbild zusammen sowie mit der Einschätzung vom Wert der Zeit. Von diesen Zusammenhängen handelt der dritte Problemkreis, den ich noch zur Diskussion vorlegen möchte.
(3) Menschenbild und Wert der Zeit: Die persönliche Erfahrungen, der gesellschaftliche und politische Alltag, auch die rechtsstaalichen Verhältnisse, wie sie hier und heute gelten, konfrontieren uns unablässig mit der offensichtlichen Ungleichwertung und Entwertung von Menschen. Wir haben diesbezüglich wohl alle unsere eigene Initiation des Unrechts und des Leidens erlebt. Diese Ungleichwertung und Entwertung hat nicht nur mit einer gleichzeitigen Häufung individueller narzisstischer Selbstüberschätzung zu tun, das heisst mit partikulären, wenngleich häufigen pathologischen Erscheinungen, sondern mit einem implizit rassistischen Gesellschaftssystem, das sich aber auf demokratische Weise vorweg als Rechtssystem konstituiert. Die öffentlich nicht nur geduldete, sondern praktizierte Verachtung und die daraus folgende Diskrimierung von Menschen, die als “Randständige” bezeichnet werden, von Armen und Fürsorgeabhängigen, von Menschen, die aus körperlichen oder aus psychischen Gründen den heute geforderten Effizienzkriterien nicht genügen können, von Asylsuchenden, insbesondere von sogenannten “Illegalen” prägt unsere gesamte schweizerische Realität. Es bräuchte eigentlich nicht des Hinweises auf das so knapp zustandegekommene positive Resultat der Antirassismus-Abstimmung oder auf die desaströse Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden zu den Zwangsmassnahmen im Ausländerbereich, ebenso wenig bräuchte es der Erinnerung an die fehlende Unterzeichnung wichtiger internationaler Konventionen durch die Schweiz, etwa der Kinderrechtskonvention oder der Sozialcharta. Die asyl-und flüchtlingspolitischen Tatsachen könnten genügen: sie sind ein Hohn auf alle Grundrechtsdeklarationen, und dies nicht nur in der Schweiz, sondern in allen Ländern Europas. Ausser für die ganz wenigen Menschen, die als Flüchtlinge anerkannt werden und die damit eine Art von “normalem” Ausländerstatus erhalten, gelten für die meisten, das heisst für Tausende von Menschen, eine Vielzahl von genau definierten Bedingungen, die als “Status” L oder F oder mit anderen Abkürzungen bezeichnet werden und die alle eine Vielzahl von Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung bedeuten: Arbeitsverbot, ständige Zumutung von Untätigkeit, Verbot des Zusmmenlebens von Familien, kollektive Wohnverhältnisse, die nicht die geringste Privatheit zulassen, demütigende Taschengeldzuteilungen, die pro Tag in Zürich nicht einmal für einen Kaffee oder für eine Tramfahrt reichen, keine freie Berufswahl für Jugendliche, vor allem aber ständig aufrechtgehaltene Unsicherheit bezüglich der Dauer des Aufenthalts, bezüglich einer möglichen Rückschaffung ins Land, in dem Leben und Sicherheit so gefährdet waren, dass Flucht und Exil unausweichlich wurden, vor allem auch ständiges Misstrauen jeder Erklärung und jedem Bedürfnis gegenüber, ständiger Vorwurf des Schmarotzertums, ständige Entwertung und Herabsetzung der menschlichen Person. Alle diese Verletzungen menschlicher Grundbedürfnisse und Grundrechte, die durch Gesetze, durch Weisungen eidgenössischer oder kantonaler Ämter und durch eine allgemeine Praxis legitimiert werden, bedeuten letztlich, dass überhaupt kein Verlass auf irgendwelche Deklarationen universeller Rechte besteht. Wo es eine einzige Ausnahme gibt, gibt es keine Universalität der Rechte. Wo es aber keine Universalität der Rechte gibt, kann letztlich jede Willkür und jedes Verbechenals legitim erklärt werden.
Wenn Feminismus als emanzipatorisches Projekt heute neu definiert werden soll, muss auf ganz zentrale Weise das bedingungslose und uneingeschränkte Bekenntnis zum gleichen Wert eines jeden Menschen die politischen Konzepte und alles zwischenmenschliche, gesellschaftliche und politische Handeln bestimmen. Nur so können Forderungen, welche die spezifische Rechts- und Lebenssituation von Frauen betreffen, überhaupt auf glaubwürdige Weise formuliert werden. Dies betrifft nicht zuletzt die Forderung nach einer menschengerechten Wertung der Zeit, das heisst nach einer Wertung, die nicht standesmässig und einkommensmässig unterschiedlich definiert ist, sondern die universalen Kriterien zu genügen vermag. Das bedeutet, dass der Warencharakter der Zeit aufgehoben werden muss – eine revolutionäre Forderung. Sie folgt jedoch notwendig aus der Forderung nach dem gleichen Respekt vor jedem Menschenleben. Es ist absurd, die sogenannt “universale” Erklärung der Menschenrechte gutzuheissen, gleichzeitig aber zuzulassen, dass zum Beispiel für einen vorläufig aufgenommern Flüchtling während Jahren Lebenszeit als Zeit der Untätigkeit, als “leere” Zeit und damit als wertlos gelten soll, oder dass eine Woche erschöpfender Arbeit am Fliessband gleichviel “wert” sein soll wie eine einzige Stunde eines Bankgeneraldirektors oder eines Marketingmanagers. Da jede Existenz zeitlich bestimmt ist, da jeder Existenz auf gleiche Weise die ungleiche Frist zwischen Geburt und Tod als Sinnauftrag aufgegeben ist, erscheint mir die Ungleichwertung der Zeit, das heisst deren Verwandlung zur wertlosen oder wertvollen Ware Ursache der tiefsten Entfremdungen zu sein und damit schwerwiegendster individueller und kollektiver Leidenserscheinungen, Depressionen und kompensatorischer Selbstwertbestätigungen, Urache von Sinnleere und Gewalt.
Als Thema für unsere gemeinsame Arbeit möchte ich daher vorschlagen, dass wir Modelle einer gerechten Zeitwertung entwickeln, nicht als Utopien, sondern als Vorgaben möglicher, das heisst realisierbarer politischer Forderungen.








